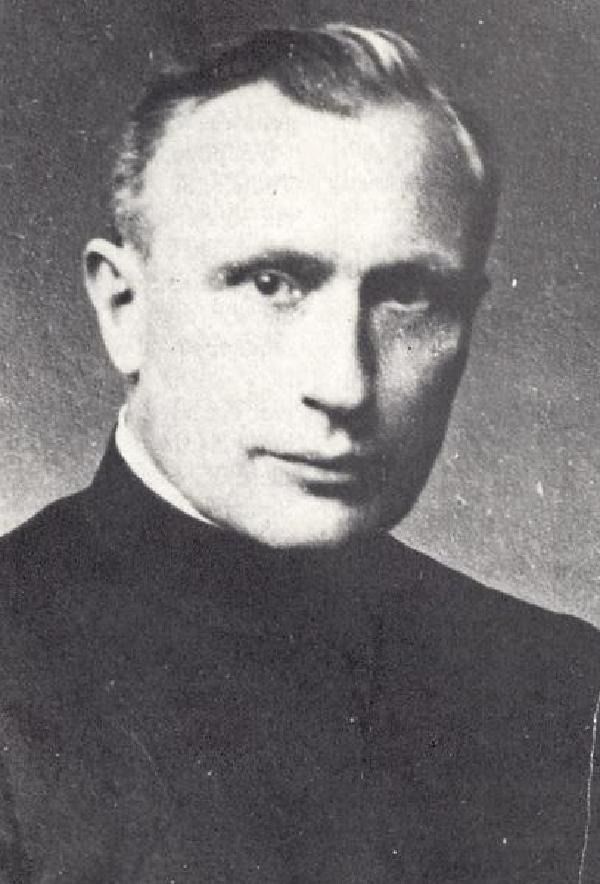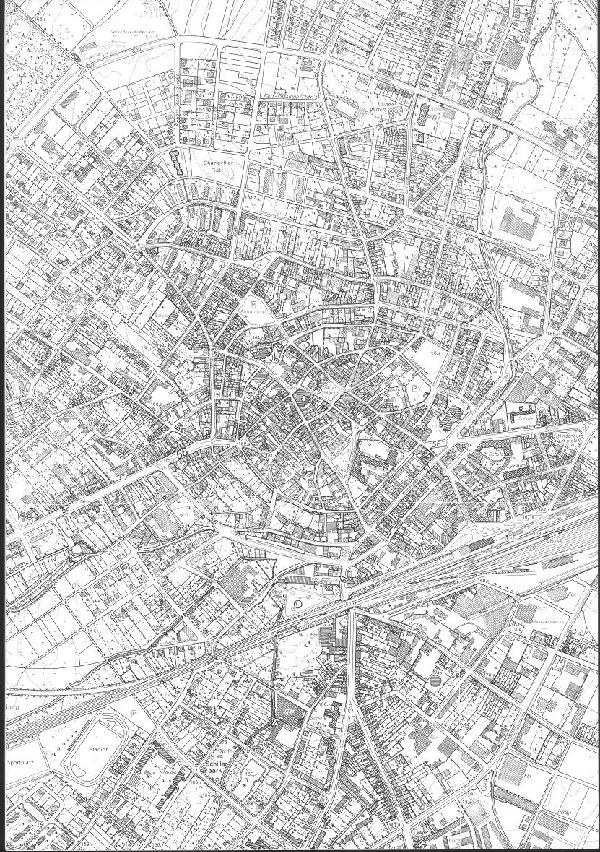Zu den Kapiteln
Schlagworte
Joseph Emonds war ein katholischer Priester und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus; er beschaffte verfolgten Juden und geistlichen Mitbrüdern Verstecke und Ausreisedokumente oder brachte sie über die belgische Grenze in Sicherheit.
Joseph Emonds wurde am 15.11.1898 in Erkelenz-Terheeg als ältester von drei Söhnen des Landwirts Peter Anton (1854–1921) und seiner Ehefrau Gertrud (1856–1921), geborene Peters geboren. Zunächst besuchte er das Progymnasium in Erkelenz, dann das Gymnasium in Mönchengladbach, an dem er 1917 das Abitur ablegte; anschließend diente er als Soldat im Ersten Weltkrieg. Ab 1918 folgte das Studium der katholischen Theologie an der Universität Bonn. Nach dem Besuch des erzbischöflichen Priesterseminars in Bensberg (heute Stadt Bergisch Gladbach) wurde er am 13.8.1922 im Kölner Dom von Kardinal Schulte zum Priester geweiht. 1922-1924 war er Kaplan an der Herz-Jesu-Kirche in Aachen. Es folgten weitere zwei Jahre als geistlicher Krankenhausrektor in Dormagen. Die Armut der unterer Bevölkerungsschichten, mit der er hier konfrontiert wurde, veranlasste ihn, sich sozial engagierte. Vor diesem Hintergrund rückte er politisch stärker nach links, kritisch beoachtet von der geistlichen Obrigkeit, die ihn 1926 Kaplan an die St. Peter-Kirche in Köln-Ehrenfeld versetzte.

Joseph Emonds (hintere Reihe, dritter von links, stehend) während seiner Jugendjahre. (Privatarchiv Hubert Rütten)
Emonds begann mit der christlichen Jugendarbeit, indem er die geistliche Leitung des Quickborns, einer katholischen Jugendorganisation, übernahm. Auch unterhielt er Kontakte zu einer Gruppe von Jugendlichen, die sich in der NS-Zeit in der Ehrenfelder-Gruppe der oppositionellen „Edelweißpiraten“ sammelten. In dieser Zeit lernte Emonds den gerühmten Religionsphilosophen Romano Guardini (1885-1968) kennen, mit dem er rege Diskussionen führte. Doch Emonds' Zeit in Köln war begrenzt: Wieder war die Obrigkeit mit seiner politischen Haltung und seinem gesellschaftlichen Umgang nicht einverstanden; 1928 wurde er an der Kirche St. Laurentius im Essener Stadtteil Steele versetzt. Dort erlebte er den Aufstieg des Nationalsozialismus und den endgültigen Untergang der Weimarer Republik. Auch nach der Berufung Adolf Hitlers (1889-1945) zum Reichskanzler 1933 blieb Emonds seinen politischen Ansichten treu und kritisierte das NS-Regime. In Essen knüpfte er weitere Kontakte zur mittlerweile verbotenen SPD und den im Untergrund lebenden Kommunisten; dort machte er auch die Bekanntschaft des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann , mit dem ihn bis zu seinem Tod eine Freundschaft verband.
Bereits früh, ab Sommer 1933, erkannte Emonds die Gefahr für Gegner des Nationalsozialismus und half Verfolgten, wie Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden, Ausreisedokumente oder Verstecke zu beschaffen. Auch katholische Geistliche, die von der Gestapo als Regimegegner eingestuft wurden, erhielten seine Unterstützung. Dieses Engagement und seine regimekritischen Predigten brachten ihm die Aufmerksamkeit der Gestapo ein, die ihn bereits seit 1933 systematisch beschattete. Im Juni 1934 wurde er das erste Mal von der Gestapo verhört und wegen seiner „staatsabträglichen Predigtäußerungen“ offiziell verwarnt. Im Januar 1935 geriet er durch die Anzeige einer Privatperson wegen des gleichen Vergehens erneut in das Visier der Gestapo; die Ermittlungen führten zwar ins Leere, jedoch erhöhte sich das Risiko einer Verhaftung mit jedem Tag. So wurde er 1938 zu seinem Schutz erneut versetzt. Als Pfarrer war er nun in Kirchheim (heute Stadt Euskirchen) tätig, wo er zumindest dem direkten Blickfeld der Gestapo entzogen war und sich wieder verstärkt seiner inoffiziellen Arbeit widmen konnte. Zunächst schloss er sich einem theologischen Diskussionskreis um den katholischen Arzt Dr. Josef Kill (1897-1969) in Bonn an und organisierte schon bald selbst diese Treffen. Wahrscheinlich erfuhr er bei einer dieser Zusammenkünfte von den Attentatsplänen des 20.7.1944 und hatte wohl auch Kontakt zu den Verschwörern.

Joseph Emonds (1898-1975). (Privatarchiv Hubert Rütten)
Joseph Emonds unterhielt außerdem Kontakt mit seinem ehemaligen Bensberger Studienfreund Jupp N., der mittlerweile SS-Mann in der Düsseldorfer Gestapo-Leitstelle war. Durch ihn erhielt Emonds verschlüsselte Listen mit Namen der Personen, die kurz vor dem Abtransport in ein Konzentrationslager standen. Diese Listen wurden zunächst an die Adresse von Emonds' Haushälterin geschickt, dort dechiffriert und anschließend an eine Bekannte nach Köln weitergeleitet, die er aus seiner Zeit als Kaplan in Köln-Ehrenfeld kannte. Diese gab die Namenslisten an das Generalvikariat in Köln weiter, dem so die Rettung vieler Juden und katholischer Geistlicher gelang.
Joseph Emonds war auch in einem organisierten Ring aktiv, der Juden und andere Regimeverfolgte vor der Gestapo versteckte oder über die belgische Grenze brachte. Als die Leiterin des Rings, Gräfin Maria Elisabeth zu Stolberg (1912-1944) aus Düren, bei einem Bombenangriff ums Leben kam, übernahm der Kirchheimer Pfarrer die Organisation. Ab 1944 war Emonds Dechant des Dekanates Münstereifel (heute Stadt Bad Münstereifel); er stellte auch sein Pfarrhaus als Unterkunft für Verfolgte zur Verfügung. Zu einer besonders gefährlichen Situation kam es, als sich das verfolgte Ehepaar Barz im Dachgeschoss des Pfarrhauses versteckte, während sich im Erdgeschoss ein SS-Trupp befand. Der Maler Mathias Barz (1895-1982) war mit der jüdischen Schauspielerin Brunhilde Stein (1896-1965) verheiratet; sie, lebten in einer sogenannten „Mischehe“. Nach einem Gefängnisaufenthalt und Jahren der Verfolgung sollte sich Brunhilde schließlich zur Deportation melden. Das Paar floh und kam im Pfarrhaus von Dechant Emonds unter. Im Zuge der Vorbereitungen der Ardennen-Offensive war jedoch zur gleichen Zeit eine Gruppe von SS-Männern dort untergebracht. Emonds konnte die Anwesenheit des Ehepaares geheim halten und es sogar von den Essensresten der SS heimlich ernähren. Allen Beteiligten war jedoch klar, dass die beiden dort nicht länger bleiben konnte; Emonds organisierte weitere Unterkünfte und sie blieben bis zum Kriegsende unentdeckt.

Die Haushälterin Joseph Emonds Anna Schürkes. (Privatarchiv Hubert Rütten)
Das Ehepaar Barz war es auch, welches die mutigen Taten des Dechanten Emonds publik machte: In einer Sendung des WDR mit dem Titel „Der 20. Juli“ (20.7.1961) - Zweitausstrahlung unter dem Titel „Von der Gestapo gejagt“ (20.7.1964) - berichteten sie über Joseph Emonds und wie er sie und andere Verfolgte gerettet hatte.
Joseph Emonds blieb bis zu seinem Tod am 7.2.1975 in Kirchheim Dechant des Dekanates Münstereifel. Seine letzte Ruhestätte fand er in Erkelenz.
Seit 1984 trägt eine Schule in Kuchenheim (heute Stadt Euskirchen) seinen Namen. In seiner Geburtsstadt Erkelenz soll ein Neubaugebiet nach ihm benannt werden.
Im Sommer 2014 soll er von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“ für seine Verdienste als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt werden.
Werke
Heimat und Erde, Regensburg 1936, 1938.
Glaube und Symbol, Regensburg 1936.
Kühnheit des Herzens, Die heilige Theresia von Lisieux, Heidelberg 1949.
Literatur
Arntz, Hans-Dieter, Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy, Euskirchen 1990, S. 712-716.
Arntz, Hans-Dieter, Judaica. Juden in der Voreifel, Euskirchen 1983, S. 456-459.
Hehl, Ulrich von (Hg.), Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung, 3. Auflage, Band 1, Paderborn [u.a.], S. 715-716.
Rütten, Hubert, Lebensspuren – Spurensuche. Jüdisches Leben im ehemaligen Landkreis Erkelenz, Erkelenz 2008.

Joseph Emonds bei einer Grundsteinlegung nach 1945. (Privatarchiv Hubert Rütten)
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Saam, Alena, Joseph Emonds, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/joseph-emonds/DE-2086/lido/58298a30b8fe41.52552087 (abgerufen am 17.04.2024)