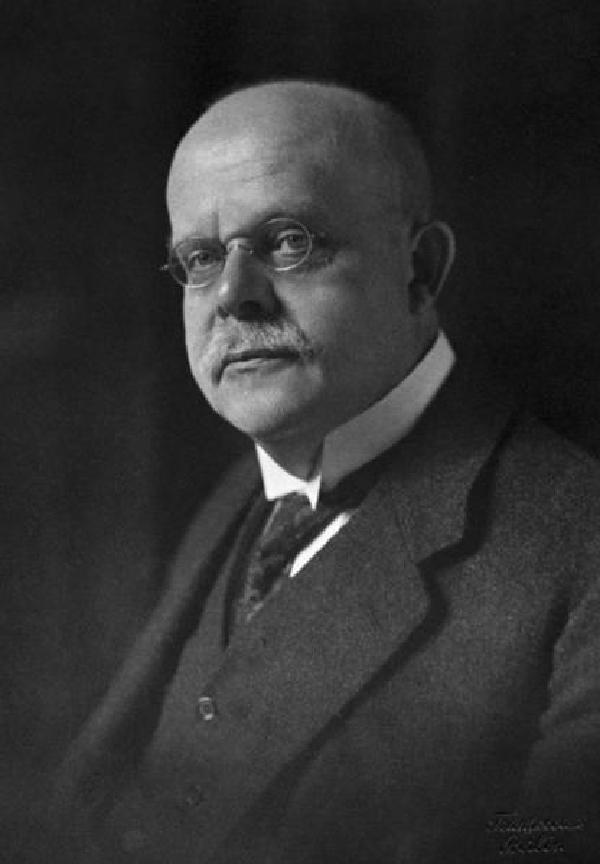Zu den Kapiteln
Gegen Ende der Weimarer Zeit bis zu seiner Auflösung in der NS-Zeit war Paul Franken Geschäftsführer des katholischen Akademikerverbandes KV und geriet als Widerstandskämpfer in Gestapo-Haft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er auf Wunsch des Bundeskanzlers Konrad Adenauer Gründungsdirektor der späteren „Bundeszentrale für politische Bildung“, die er maßgeblich prägte.
Franken wurde am 19.12.1903 in Mönchengladbach geboren, ging zeitweise in Münstereifel (heute Bad Münstereifel) zur Schule und begann nach dem Abitur 1923 ein Theologiestudium an der Universität Bonn. Im Sommersemester 1924 trat er dem Katholischen Studentenverein „Arminia“ bei, der dem „Kartellverband der katholischen Deutschen Studentenvereine“ (KV) angehört. Als Franken dort „aktiv“ wurde, hatten Mitglieder dieser Korporation in verschiedenen rheinischen Großstädten führende politische Ämter inne: Konrad Adenauer war Oberbürgermeister von Köln, Heinrich Weitz (1890-1962) von Trier, Franz Gielen (1867-1947) von Mönchengladbach und Wilhelm Farwick (1863-1941) von Aachen; Wilhelm Marx war Reichskanzler, Johannes Henry (1876-1958) Fraktionsführer des Zentrums in der Stadt Bonn, Johannes Horion Landeshauptmann der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz mit Sitz in Düsseldorf; dort war Walter Hensel (1899-1986) Stadtsyndikus. Keine katholische Studentenverbindung hatte in der Weimarer Republik so viele Mitglieder in herausgehobenen politischen Ämtern, wie die Arminia in Bonn. Das übte auch auf Paul Franken eine starke Anziehungskraft aus.
1926 studierte Franken für ein Semester in Berlin und beendete am 17.12.1932 in Bonn sein Studium mit der Promotion zum Dr. phil. Seine bei Alois Schulte (1857-1941) eingereichte Dissertation hatte das Thema: „Franz Bernhard von Buchholtz bis zu seiner Übersiedlung nach Wien (1790-1818, Jugend und politische Wanderjahre)“. Eine zeitweise angestrebte Habilitation schloss Franken nicht ab.
Schon 1930 wurde Franken stellvertretender Verbandsgeschäftsführer des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenvereine. 1932 übernahm er von dem Bonner Zentrumspolitiker und Rechtsanwalt Johannes Henry die Aufgabe des Verbandsgeschäftsführers des KV. Franken warnte in jenen Jahren die Mitglieder des KV vor dem Nationalsozialismus, dessen Ideologie er für unvereinbar mit der Lehre der katholischen Kirche hielt, weswegen er im Einvernehmen mit den deutschen Bischöfen für Katholiken eine Mitgliedschaft in der NSDAP per se ausschloss. Er war Mitglied der Zentrumspartei, wählte aber nach eigenen Aussagen bei der Reichstagswahl im März 1933 die Bayerische Volkspartei. Im März/April 1933 verzichtete Franken auf sein Stimmrecht im Verbandsrat des KV. Er trug die Politik des Verbandes, die sich dem Nationalsozialismus öffnete, nicht mit und beschränkte sich auf die administrative Tätigkeit als Verbandsgeschäftsführer.
Im Mai 1933 trat er der NSDAP bei. Er glaubte, damit für die Belange des katholischen Verbandswesens mehr erreichen zu können, als ein Außenstehender. Mit dieser Bewertung hatte er sich – wie viele seiner Zeitgenossen – geirrt. Als Verbandsgeschäftsführer musste er selbst die „Abwicklung“ des KV vornehmen. Sie bestand zunächst im Zusammenschluss mit anderen katholischen Studentenverbänden zur „Katholischen Burschenschaft“ am 3.9.1933. Nach der Entkonfessionalisierung des Verbandes am 30.1.1934 erfolgte der Umbau zum „Kartellverband deutscher Burschenschaftlicher Verbindungen“. Mit der Liquidation dieses Verbandes am 31.3.1936 wurde Franken erwerbslos.
Seit 1933 stand Franken in engerem Kontakt zu seinem Bundesbruder aus der Bonner Arminia, Konrad Adenauer, der von 1933 bis 1934 in dem Benediktinerkloster Maria Laach untergetaucht war. Franken hat wiederholt Frau und Kinder Adenauers in die Eifel gefahren, wo die Familie nur unter konspirativen Verhältnissen zusammenkommen konnte, weil ständig die Gefahr der Beobachtung durch NS-Spitzel drohte. Gleichzeitig unterhielt Franken enge Kontakte zum rheinischen Widerstandskreis, der sich unter anderem aus dem späteren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Karl Arnold, dem späteren Düsseldorfer Oberstadtdirektor Walter Hensel, dem ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister und späteren Bundesminister Robert Lehr, dem späteren stellvertretenden Bundespressesprecher Edmund Forschbach (1903-1988), ferner Michael Rott (1898-1947) sowie den Gewerkschafter und langjährigen Bonner Stadtverordneten für die Zentrumspartei Bernhard Deutz (1888-1964), Peter Maria Busen (1904-1967) und dem christlichen Gewerkschaftsführer Heinrich Körner (1892-1945), der ein Opfer des 20.7.1944 wurde, zusammensetzte. Dieser Kreis hielt unter anderem über den christlichen Gewerkschafter und späteren Bundesminister Jakob Kaiser (1888-1961) sowie über den späteren bayerischen Justizminister Joseph Müller („Ochsensepp“, 1898-1979) Kontakte zu anderen regionalen Widerstandskreisen sowie insbesondere zu den Generalobersten der Wehrmacht in Berlin, Kurt von Hammerstein-Equord (1878-1943) und Werner von Fritsch.
Wiederholt versuchte Franken, auch Adenauer mit dem rheinischen Widerstandskreis zusammenzubringen, was dieser ablehnte und Frankens Agieren als „Dummheit“ bezeichnete. Am 1.11.1937 hatte die Gestapo den Düsseldorfer Stadtsyndikus Walter Hensel unter dem irrigen Verdacht festgenommen, mit ihm einen gesuchten führenden Kommunisten zu haben. Unter Folter brachte Hensel auch Franken in Gefahr, der am 10.11.1937 von der Gestapo ohne Haftbefehl wegen des Verdachts des Hochverrats in „Schutzhaft“ genommen wurde. Erst am 7.4.1938 wurde gegen ihn wegen Vergehens gegen das „Heimtückegesetz“ ein Haftbefehl erlassen, der am 7.5.1938 aufgehoben wurde, ohne das Franken freigelassen wurde; das Strafverfahren selbst wurde Anfang Juli 1938 eingestellt. Erst auf Intervention seines Bruders Heinrich Franken sowie seines Bundesbruders Martin Spahn (1875-1945) wurde Paul Franken nach fast 15 Monaten schließlich am 25.1.1939 aus dem Polizeigefängnis in Düsseldorf entlassen. Aus dem rheinischen Widerstandskreis war außer Hensel und Franken in jenen Monaten auch Jakob Kaiser dort inhaftiert. Franken musste sich nach seiner Freilassung zunächst täglich, später wöchentlich bei der Gestapo melden, wurde mit Reiseverbot belegt und zusätzlich wurde eine Passsperre über ihn verhängt.
Seit Oktober 1939 studierte Franken in Göttingen Geschichte, Geographie und Philosophie mit dem Ziel des Höheren Lehramts. Im April 1940 kehrte Franken nach Bonn zurück. Im Januar 1941 wurde – vorgeblich wegen seines zu hohen Alters – ihm die Zulassung zum Ersten Staatsexamen in Bonn abgelehnt. Daraufhin war er bis Dezember 1942 als Privatlehrer (Nachhilfelehrer) in Bonn tätig.
1939 trat Franken aus der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) aus; 1940 wurde er aus der NSDAP ausgeschlossen. Erst im Frühjahr 1944 schloss er sich mit seinem Beitritt zur Deutschen Arbeitsfront (DAF) wieder einer NS-Organisation an. Franken blieb trotz der Überwachung durch die Gestapo mit den rheinischen Widerstandskreisen in engem Kontakt.
Um dem Einsatz als Frontsoldat zu entgehen, bemühte Franken seine Widerstandskreise um eine Verwendung in einem Dolmetscherkorps, doch trat er schließlich Ende 1942 auf Vermittlung des ehemaligen christlichen Gewerkschaftsführers Bernhard Letterhaus mit der Wehrwirtschaftsstelle der Wehrmacht in Köln in Kontakt, dessen Oberkommando ihn zum 1.1.1943 einzog. Franken kam ins Amt Ausland/Abwehr unter Admiral Wilhelm Canaris (1887-1945) und wurde in Rom dienstverpflichtet. Zur Tarnung seiner dortigen Abwehrtätigkeit erhielt Franken ein Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (seit 1949 Deutsche Forschungsgemeinschaft), um sich am Deutschen Historischen Institut in Rom an der Edition von Nuntiaturberichten aus der Zeit der Westfälischen Friedensverhandlungen zu beteiligen. So konnte er vorgeblich zu wissenschaftlichen Studien in die Vatikanische Bibliothek und in das Vatikanische Archiv gelangen. Tatsächlich aber fungierte er bis März 1944 als Verbindungsmann zwischen Widerstandsgruppen in Berlin und dem Vatikan. Die Bedeutung seiner Abwehrtätigkeit in Rom wurde von Franken nach dem Krieg jedoch überschätzt oder zumindest überbewertet; immerhin hat er mit Joseph Müller konspiriert, der wiederum über den ehemaligen Zentrumsvorsitzenden Ludwig Kaas und den Jesuitenpater Robert Leiber (1887-1967) auch mit Papst Pius XII. (Pontifikat 1939-1958) in Kontakt stand.
Ziel der Abwehrtätigkeit war es, Pius XII. zu bewegen, sich bei den Amerikanern und Briten dafür stark zu machen, dass diese sich bei einer Veränderung der politischen Machtverhältnisse in Deutschland sofort mit einer neuen Regierung über einen gerechten Frieden verständigen und ihrerseits auf Siegerjustiz verzichten würden. Als jedoch das Attentat auf den „Reichskanzler und Führer“ Adolf Hitler (1889-1945) am 20.7.1944 scheiterte, waren Amerikaner und Briten nicht mehr bereit, mit einer neuen Führungselite zusammenzuarbeiten, die sich nicht einmal Adolf Hitlers „entledigen“ könne.
Im März 1944 nach Bonn zurückgekehrt, wurde Franken zum Kriegsgefangenenlager „Stallag VI“ abkommandiert. Erst auf Drängen der Gestapo wurde er zum 30.6.1944 aus dem Dienst entlassen; schon Mitte Juni 1944 war er nach Bad Neuenahr zur Kur gegangen. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20.7.1944 und der Verhaftung von Heinrich Körner versteckte sich Franken bis März 1945 in der Wohnung des Professors für Chirurgie Ernst Derra (1901-1979) an der Argelanderstraße 177 in Bonn. Die letzten Tage bis zum Einmarsch der Amerikaner in Bonn verbrachte Franken mit deutschen Soldaten, italienischen Kriegsgefangenen und deutschen Zivilisten in einem Luftschutzbunker. Im Zuge der Entnazifizierung wurde Franken am 18.6.1947 als „politisch Verfolgter“ eingestuft.
Franken betätigte sich 1946 aktiv an der Gründung der CDU in Bonn und betrieb die Gründung katholischer Studentenverbindungen. Sein ehrenamtliches Engagement galt der Reaktivierung des Kartellverbandes der Katholischen deutschen Studentenvereine (KV), dessen Vorsitzender er 1951-1957 und 1961-1965 war.
Beruflich war er nach 1945 zunächst als Nachhilfelehrer tätig; 1949 wurde er Dozent an der Hochschule Vechta und 1950 deren Direktor. Ab 1952 leitete er auf Vorschlag von Konrad Adenauer die „Zentrale für den Heimatdienst“, die seit 1963 „Bundeszentrale für politische Bildung“ heißt. Zu den herausragenden auf ihn zurückgehenden Produkten gehört bis heute die Beilage zur Zeitung „Das Parlament“ mit dem Titel „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ). Von Beginn an propagierte Franken die Errichtung von „Landeszentralen“ zur politischen Bildung bei den jeweiligen Landesregierungen. Nach seiner Beförderung zum Regierungsdirektor 1954 und zum leitenden Regierungsdirektor 1955 wurde er am 4.12.1968 als Direktor der Bundeszentrale pensioniert. Er erhielt am 14.12.1968 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Aus Gram über den plötzlichen Tod seines Stiefsohns starb Franken am 15.12.1984 in Bonn, wo er auf dem Bonner Südfriedhof begraben wurde.
Quellen
Ungedruckt
Universitätsarchiv Bonn: Immatrikulationsmanual, Band 19: 1922-1927; Nachlass Paul Egon Hübinger.
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland: RW 58–37984 und RW 58–64380 (Gestapo-Akten Franken).
Archiv für christlich-demokratische Politik der Konrad Adenauer Stiftung, Bestand I-013 (Nachlass Franken).
KV-Archiv 12/21 (Briefwechsel zwischen Franken mit Martin Spahn).
Bundesarchiv Koblenz: Nachlass Jakob Kaiser, Nr. 9 (Briefwechsel Kaiser/Franken 1951-1954).
Gedruckt
Just, Leo, Briefe an Hermann Cardauns, Paul Fridolin Kehr, Aloys Schulte, Heinrich Finke, Albert Brackmann und Martin Spahn 1923-1944. Hg., eingeleitet und kommentiert von Michael F. Feldkamp, Frankfurt am Main [u.a.] 2002.
Werke (Auswahl)
Franz Bernhard von Buchholtz bis zu seiner Übersiedlung nach Wien (1790-1818, Jugend und politische Wanderjahre, Diss. phil. Univ. Bonn 1932 [ungedruckt].
65 Jahre Arminia, in: Arminenblätter Nr. 23, 1928.
Bernhard Braubach †, in: Arminenblätter Nr. 29, 1932.
Organisation und Struktur des K.V., in: Akademische Monatsblätter Jg. 44, Februar 1932, Nr. 5, S. 170-173.
Das Arbeitsgebiet des Religiös-Weltanschaulichen Ausschusses Akademische Monatsblätter Jg. 44, Februar 1932, Nr. 5, S. 173-175.
Beschlüsse und Entschließungen der 57. V.V. [= Vertreterversammlung] und des 10. ordentl[ichen] Philstertages in Würzburg 1932, in: Schwarzes Brett. Beilage zu Nr. 9 der Akademischen Monatsblätter Jg. 33, Juli 1932, Nr. 9, S. 254.
Würzburg 1932 [Bericht vom Philistertag des KV], in: Akademische Monatsblätter, Jg. 44, Juli 1932, Nr. 9, S. 353-359.
Zum Rücktritt Dr. Walther Hensels, in: Akademische Monatsblätter, Jg. 44, Juli 1932, Nr. 9, S. 378-379.
Verbandsbrief [des KV] Nr. 1 vom 3. Nov. 34, Finanzpolitik in kritischer Zeit, in: Arminenblätter Nr. 31, 1935.
Bericht über den Arminentag am 26. Januar 1936, in. Arminenblätter Nr. 32, 1936.
[Anonym,] Das Ende der Korporationen, in: Arminenblätter Nr. 33, 1936.
Der 20. Juli und das Rheinland, in: Kölnische Rundschau 18.7.1947.
Lehr, Robert/Franken, Paul, Bundeszentrale für Heimatdienst kein staatliches Propagandainstrument, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 53, 1952.
[Anonym] 20 Jahre später. Eine Erinnerung an den Achtzigjährigen [Konrad Adenauer] zum 5. Januar 1956, in: Akademische Monatsblätter 68, 1956, Nr. 4, S. 94-100.
Strukturen der politischen Bildung in der Bundesrepublik, in: Neue Gesellschaft, 1967.
Literatur (Auswahl)
Akademische Monatsblätter, Februar 1979.
Benda, Ernst, Ein Baumeister der Demokratie in: Das Parlament Nr. 50 vom 17.12.1983.
Buchstab, Günter/Kaff, Brigitte/Kleinmann, Hans-Otto, Verfolgung und Widerstand 1933-1945. Christliche Demokraten gegen Hitler. Düsseldorf 1986.
Catarius, Ulrich, Opposition gegen Hitler. Ein erzählender Bildband. Mit einem Essay von Karl Otmar von Aretin, Berlin 1984, S. 201-202.
Esser, Theodor Richard, Erinnerungen an Paul Franken, in: Arminenblätter Nr. 107, 1988, S. 10-16.
Feldkamp, Michael F., Arminia 1946: Zwischen Neubeginn und Tradition, in: Arminenblätter Nr. 122, 1996, S. 12-15.
Feldkamp, Michael F., Franken, Paul, in: Koß, Siegfried/Löhr, Wolfgang (Hg.), Biographisches Lexikon des KV, Teil 6, unter Mitarbeit von Gisela Hütz ( Revocatio historiae. Schriften der Historischen Kommission des Kartellverbandes katholischer deutscher Studentenvereine [KV] in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte [GDS], Band 7), Köln 2000, S. 30-34.
Feldkamp, Michael F., Paul Franken (1903-1984). Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung, in: Buchstab, Günter/Kaff, Brigitte/Kleinmann, Hans Otto (Hg.), Christliche Demokraten gegen Hitler. Aus Verfolgung und Widerstand zur Union, Freiburg im Breisgau [u.a.], 2004, S. 172-178.
Forschbach, Edmund, Vom Widerstand zum Aufbau. Ein Erlebnisbericht aus den Jahren 1931-1939, in: Informations-Dienst des Zonenausschusses der Christlich-Demokratischen Union, Köln, 4. Jahrgang 1950: Heft Nr. 13 (1.4.1950), S. 6 [1. Teil]; Heft Nr. 14 (6.4.1950), S. 5-6 (1. Fortsetzung); Heft Nr. 15 (15.4.1950), S. 5 (2. Fortsetzung); Heft Nr. 16 (21.4.1950), S. 5-6. (3. Fortsetzung); Heft Nr. 17 (26.4.1950), S. 4 (4. Fortsetzung); Heft Nr. 18 (29.4.1950), S. 8 (5. Fortsetzung); Heft Nr. 19 (3.5.1950), S. 6 (6. Fortsetzung); Heft Nr. 20 (6.5.1950), S. 5 (7. Fortsetzung); Heft Nr. 21 (10.5.1950), S. 6 (8. Fortsetzung); Heft Nr. 22 (13.5.1950), S. 6 (Schluss).
Gielen, Viktor, Paul Franken (1903-1984), in: Feldkamp, Michael F. (Hg.), Arminia 1863-1988. Festschrift zum 125jährigen Bestehen des katholischen Studentenvereins Arminia (Bonn 1989), S. 221-224.
Hentges, Gudrun, Neuanfang staatlicher politischer Bildung: Die Bundeszentrale für Heimatdienst 1952-1963, in: APuZ –- Aus Politik und Zeitgeschichte 62. Jg, 46-47 Heft 2012, 12. November 2012, S. 35-43.
Mensing, Hans Peter (Bearb.), Adenauer im Dritten Reich, Berlin 1991.
Rommerskirchen, Josef, Ein Leben für die Freiheit, in: Das Parlament Nr. 50 vom 17.12.1983.
Rösgen, Hermann-Josef, Die Auflösung der katholischen Studentenverbände im Dritten Reich, Dortmund 1995.
Schreckenberg, Wilhelm, „Mahner der Demokratie“. Zum Tode von Paul Franken, in: Akademische Monatsblätter 97, Heft 2, Februar 1985, S. 1-3.
Schröder, Stephen, Dr. Paul Franken (1903–1984): Ein katholischer Akademiker in den rheinischen Widerstandskreisen, in: HPM 17, S. 175-203.
Senff, Heinzgeorg, Politische Bildung und Staatsbewußtsein, in: Arminenblätter Nr. 47, 1955.
Vomland, Konrad, Dr. Paul Franken. Mahner zur demokratischen Gewissensbildung“, in: Rheinischer Merkur vom 18. Juli 1969, wiederabgedruckt in: Akademische Monatsblätter 81 (1969), S. 317.
Weber, Willi, „Onkel Paul“ Am Rande notiert. Eine Erinnerung, in: Das Parlament Nr. 50 vom 17.12.1983.
Weyer, Rupert van de, Die Ehrenphilister, in: 100 Jahre Rheno-Borussia Bonn, Bonn 1996, S. 143-144.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Feldkamp, Michael F., Paul Franken, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/paul-franken/DE-2086/lido/57c6be9caae8b7.99730258 (abgerufen am 24.04.2024)