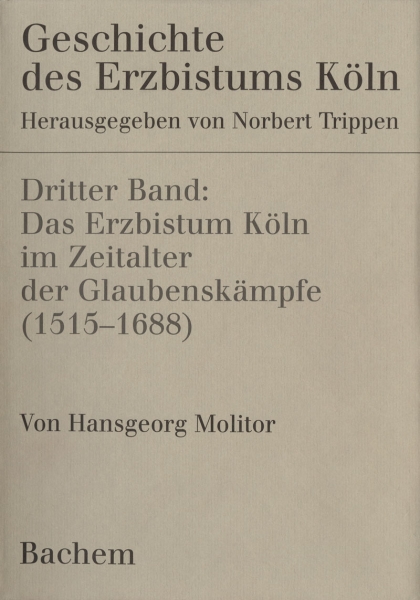Epochen
Knapp ein halbes Jahrhundert nachdem der Bonner Kirchenhistoriker und Domkapitular Wilhelm Neuß 1960 seine Konzeption einer „Geschichte des Erzbistums Köln“ veröffentlichte, kommt mit der hier angezeigten Publikation das fünfbändige Gesamtwerk zum Abschluss. Als „opus magnum“ war die Arbeit an diesem Band gleichsam ein akademischer Wegbegleiter Hansgeorg Molitors, inzwischen emeritierter Professor für Rheinische Landesgeschichte und Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Durchsicht des für ein solches Handbuch durchaus umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnisses (S. 21-68) ist nicht nur ein Zeugnis für die lange, intensive Beschäftigung des Verfassers mit der (Landes-) Geschichte im konfessionellen Zeitalter, sondern belegt zugleich eindrucksvoll, wie der Verfasser auch einschlägige Untersuchungen zu diesem Themengebiet angestoßen und als wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten begleitet hat. Der Band stellt somit geradezu eine Symbiose eines wichtigen Forschungsschwerpunktes des Autors dar.
Die Strukturierung des Bandes ist im Wesentlichen in der Konzeption des Gesamtwerks festgelegt. Auf eine Einordnung von weltlichem und geistlichem Sprengel des Kölner Erzbistums in die politischen und geistigen Zusammenhänge der Epoche (S. 69-133) folgt die Reihe von (Kurz-) Biographien der Erzbischöfe in chronologischer Abfolge (S. 141-262), wobei den Amtszeiten und der Bedeutung der Amtsträger im konfessionellen Zeitalter folgend neben Hermann V. von Wied und vor allem Gebhard Truchseß von Waldburg auch Salentin von Isenburg und Ferdinand von Bayern besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Den biographischen Darstellungen der Bischöfe „in ihrer Zeit“ hat Molitor noch unter der Überschrift „Das Bild des Bischofs und die Wirklichkeit in Köln“ ein gesondertes Kapitel vorangestellt (S. 135-140), in dem er das „Spannungsfeld zwischen geistlichen Aufgaben und Regierungsführung“ sowie das Idealbild des Bischofs nach den Beschlüssen des Tridentinums gleichsam als Hintergrundfolie für die folgenden Einzeldarstellungen konturiert. Es schließt sich ein Hauptkapitel zur Institutionengeschichte an, in der die Gremien und Funktionen der Leitung des Erzbistums (Domkapitel, Generalvikare, Weihbischöfe, Offiziale und Kirchenrat) ebenso behandelt werden, wie die intermediären Gewalten (Archivdiakonate und Dekanate) sowie die Entwicklung der Pfarreien (S. 263-330).
Entsprechend dem prägenden Themenkomplex im Untersuchungszeitraum steht im Mittelpunkt des Buchs das Kapitel zu Reform, Reformation und Gegenreformation (S. 331-471). Es hat sich nach Auffassung des Rezensenten bewährt, unter Inkaufnahme mancher unvermeidbarer Überschneidungen mit anderen Kapiteln des Buches an dieser Stelle mit einem profunden Überblick alle wesentlichen Entwicklungen, Akteure, Gruppierungen und Facetten der Ereignis- und Strukturiergeschichte zusammenfassend darzustellen. Auf dem aktuellen Forschungsstand werden neben den Reformationsversuchen Hermanns von Wied und des Gebhard Truchseß von Waldburg beispielsweise die Rolle von den Augustinern für die frühe Reformation, von Glaubensflüchtlingen und Täufern, die zeitgenössischen Diskurse zu Laienkelch, Konkubinat und Priesterehe sowie die Hexenverfolgung behandelt.
Mit dem fünften Abschnitt zu „Klerus und Klöster“ (S. 473-641) folgt die Publikation dann wieder dem Standardschema der Gesamtreihe, wobei der Bogen vom Seelsorge- und Stiftsklerus über den Ordensklerus bis hin zu den Semireligiosen und ordensähnlichen Gemeinschaften gespannt wird. Dabei werden beispielsweise in den Abschnitten zur Priesterausbildung, zum Aufkommen neuer Ordensgemeinschaften, wie etwa die Jesuiten und die Ursulinen, oder die aus Reformströmungen älterer Orden hervorgehenden neuen Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Kapuziner und die Franziskaner-Rekollekten (Observanten), und zur Aufhebungen von Klöstern während der Reformationszeit („Säkularisationen“) spezifische Aspekte im Untersuchungszeitraum der Studie aufgegriffen. Gerade das 17. Jahrhundert ist aus ordensgeschichtlicher Sicht für den Nordwesten des Alten Reichs und auch die Erzdiözese Köln geprägt von einem regelrechten „Gründungsboom“, an dem stärker kontemplativ ausgerichtete Strömungen ebenso Anteil hatten, wie solche, die beispielsweise in Schulunterricht oder Krankenpflege ihr Apostolat suchten und verwirklichten. Die „Aufteilung“ des Jahrhunderts auf die Bände 3 und 4 der Geschichte des Erzbistums lässt freilich die Bedeutung des 17. Jahrhunderts als Blüte des Ordenswesen erst in der Zusammenschau recht deutlich erkennbar werden.
Mit dem Abschnitt zu Klerus und Ordenswesen spannt sich der Bogen in der Darstellung Molitors hin zu Kapitel 7 (Bildungseinrichtungen, S. 763-797), kam doch das im Untersuchungszeitraum grundlegend neu auf- und ausgebaute höhere Schulwesen – sowohl für Jungen als auch von Mädchen – seit Mitte des 16. Jahrhunderts ganz überwiegend in die Hand von Orden und ordensähnlichen Gemeinschaften, sei es in der Verantwortung neuer Orden wie der Jesuiten, Welschnonnen oder Ursulinen, sei es, dass sich ältere Orden dem Schulwesen als neuer Aufgabe verstärkt widmeten wie beispielsweise Minoriten, einzelne Provinzen der Franziskaner-Rekollekten oder auch Drittordensgemeinschaften. Der Abschnitt zum Collegium Germanicum als Ausbildungsinstitut für angehende Priester in Rom schlägt noch einmal den Bogen zum Unterkapitel Priesterausbildung in Kapitel 5.
Im Kapitel zu „Seelsorge und Frömmigkeit“ (S. 643-761) schließlich bieten insbesondere die Ausführungen zur Rolle des Buchdrucks, der Umgang mit den Sakramenten und Heiligenkult vor dem Hintergrund der reformatorischen Kritik, Kontinuitäten und Weiterentwicklungen im Bruderschaftswesen sowie zu Prozessionen und Wallfahrten wichtige Hinweise für die zeitgenössischen Entwicklungen.
Die Benutzbarkeit des Handbuchs wird neben der klaren Gliederung insbesondere durch ein ausführliches Orts-, Personen und Sachregister (S. 817-864) gewährleistet. Bewusst verzichtet hat der Verfasser auf Kartenmaterial, um stattdessen auf andernorts gedruckte Karten zu verwiesen. Auch wenn für den Leser des Bandes angesichts der erfreulich häufig mit konkreten Beispielen „vor Ort“ angereicherten Darstellung zuweilen eine kartographische Orientierung hilfreich wäre, so bieten dem Nutzer der Gesamtreihe angesichts einer weitestgehend stabilen räumlichen Abgrenzung und Binnengliederung die Karten im ersten Teil von Wilhelm Janssens Band zum Spätmittelalter sowie im vierten Band Eduard Hegels schon wichtige Ankerpunkte.
Der dritte Band der Geschichte des Erzbistums Köln stellt Kontinuitäten und Wandlungen angefangen von den amtskirchlichen Strukturen bis hin zur Frömmigkeitspraxis im Zeitalter der Konfessionalisierung in eindrucksvoller Breite dar. Das Mit-, Neben- und Gegeneinander der Strömungen „von oben“ und „von unten“ werden dem Leser in exemplarischer Konkretisierung und in einer für einen breiteren Adressatenkreis verständlichen Form und Sprache vor Augen gestellt. Der Band ist der gelungene Schlussstein eines imposanten Gesamtwerks. (Erstveröffentlichung in: Rheinische Vierteljahresblätter 74(2010), S. 332-334).
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Kistenich, Johannes, Molitor, Hansgeorg, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe (1515-1688). (Geschichte des Erzbistums Köln, Band 3), Köln 2008, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Verzeichnisse/Literaturschau/molitor-hansgeorg-das-erzbistum-koeln-im-zeitalter-der-glaubenskaempfe-1515-1688.-geschichte-des-erzbistums-koeln-band-3-koeln-2008/DE-2086/lido/57d16d93812383.01640142 (abgerufen am 25.04.2024)