Zu den Kapiteln
Goltzius war ein am Niederrhein geborener bedeutender niederländischer Künstler, der für die nördlichen Niederlande den stilistischen Übergang vom Manierismus zum Frühbarock ebnete. Er trieb mit seinem umfangreichen und in zahlreichen Kopien verbreiteten Werk die technischen Möglichkeiten des Kupferstiches und der Federzeichnung an ihre Grenzen und prägte eine ganze Generation von Zeichnern und Stechern. Seine Blätter bezeugen eine bis dahin nicht gekannte Virtuosität und Wandlungsfähigkeit im Umgang mit den Zeichenutensilien und dem Grabstichel.
Hendrick Goltzius wurde einige Tage vor dem 25.1.1558 als erstes Kind des aus Kaiserwerth (heute Stadt Düsseldorf) stammenden Glasmalers Johan Gols II (1534/35 – nach 1609) und der Anna Fullings (gestorben vor 1591) in Mulbracht, dem heutigen Ortsteil Bracht der Gemeinde Brüggen, geboren. Schon bald verließ die Familie Bracht, um sich in Duisburg niederzulassen, wo der Vater 1562 das Bürgerrecht erwarb. Obwohl Goltzius´ rechte Hand infolge einer in der Kindheit zugezogenen Verbrennung verkrüppelt blieb, zeichnete er von frühester Jugend an mit so großer Leidenschaft, dass sein Vater ihn vorzeitig aus der Schule nahm und selbst im Zeichnen und Glasmalen unterrichtete. 1574/1575 begann Goltzius bei dem damals in Xanten ansässigen Kupferstecher, Schriftsteller und Diplomaten Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590) eine Lehre. Als der Glaubensflüchtling Coornhert 1577 nach Haarlem zurückkehren konnte, folgten ihm Goltzius und seine Eltern. Schon ab 1577/1578 stach Goltzius Einzelblätter und zahlreiche Folgen nach eigenen und fremden Vorlagen vornehmlich niederländischer Maler wie Johannes Stradanus (1523–1605) und Maerten de Vos (1532–1603) für die beiden bedeutendsten Graphik–Verlagshäuser in Antwerpen Philips Galle (1537–1612) und Aux Quatre Vents. Einem Zug der Zeit folgend latinisierte Heinrich Gols seinen Namen bis 1579 schrittweise zu Henricus Goltzius.
Mit 21 Jahren heiratete Goltzius die Witwe des Adriaen Matham, Margretha Jansdochter (1549/1550–1631). Sie brachte ein bescheidenes Erbe und ihren achtjährigen Sohn Jacob mit in die Ehe, den Goltzius zum Kupferstecher ausbildete. Um den Herstellungsprozess der Graphiken vom Entwurf über die Stichvorlage, den Stich selbst bis zum Druck und Vertrieb in einer Hand zu bündeln, gründete er 1582 seine eigene Druckwerkstatt. Goltzius begann jetzt vermehrt nach eigenen Vorlagen zu stechen und nahm ab 1584 zusätzlich zu seinem Stiefsohn weitere Lehrlinge an. Es ging ihm von Anfang an darum, Drucke von der höchstmöglichen künstlerischen und technischen Qualität für ein internationales Publikum von Kunstliebhabern und Kennern herzustellen. Prägend für seinen weiteren künstlerischen Werdegang wurde die Begegnung mit Carel van Mander (1548–1606), einem vielseitig gebildeten, weitgereisten Maler und Kunsttheoretiker, der sich 1583 in Haarlem niedergelassen hatte. Zwischen den beiden entwickelte sich eine intensive Freundschaft. Van Mander besaß Zeichnungen von Bartholomäus Spranger (1546–1611), einem wichtigen Vermittler des italienischen Manierismus für den Norden, die den Stil Goltzius´ eher zum Leidwesen van Manders in den Jahren 1585–1588 nachhaltig beeinflussten. Er nutzte sie als Vorlagen und ahmte ihren Stil auch bei eigenen Entwürfen nach. In der Auseinandersetzung mit Spranger entwickelte er seine gerühmte Stichtechnik. Ihre Besonderheit sind die dynamisch an- und abschwellenden Linien oder taillen. Sie erzeugen, in variablen Abständen parallel in Schwüngen und kurzen Bögen geführt oder sich in Schattenzonen in mehreren Schichten verkreuzend, die Plastizität der Körper. Goltzius´ Arbeiten waren bald sehr begehrt, schon 1586 galt er als der beste Kupferstecher der gesamten Niederlande. Um 1588 fertigte Goltzius die ersten von insgesamt 18 Clairobscur–Holzschnitten an, die von mehreren Platten gedruckt wurden, um die Wirkung der Helldunkelzeichnung auf farbigem Papier mit Tusche und Lichtern aus Deckweiß zu erreichen. Der rege geistige Austausch führte dazu, dass van Manders kunsttheoretische Überlegungen ab etwa 1588 das Schaffen Goltzius´ zu beeinflussen begannen. Van Mander wandte sich unter anderem gegen alle Übertreibungen und Verzerrungen in Figurenzeichnung und Raumanlage. Er lenkte den Blick auf die Natur und die sie idealisierenden antiken Skulpturen sowie die italienische Malerei der Hoch- und Spätrenaissance. Die Biographie des Goltzius in seinem 1604 erschienen Malerbuch ist die wichtigste Quelle zu Leben und Werk des Künstlers.
Im Oktober 1590 brach Goltzius zu einer schon länger geplanten Italienreise auf, die ihn über Venedig, Bologna und Florenz nach Rom führte, wo er am 10.1.1591 eintraf. Um nicht erkannt zu werden und ehrliche Urteile über seine Arbeiten zu hören, benutzte er den Namen Hendrick van Bracht. Während des halbjährlichen Romaufenthaltes begann er intensiv mit Kreide die berühmten antiken Skulpturen, Fresken von Raffael (1483–1520) und Sgrafittos des Polidoro da Caravaggio (um 1499–1543) zu zeichnen. Von einer Reihe der Künstler, die er während der Reise kennenlernte, fertigte Goltzius sehr lebendige und ausdrucksstarke Kreideporträts an. Rom war eine Offenbarung für ihn, denn nach der Rückkehr im Spätsommer 1591 stach er nicht mehr nach Vorlagen niederländischer Künstler, sondern orientierte sich ganz im Sinne van Manders an der Antike und den italienischen Künstlern der Hoch- und Spätrenaissance. Die Jahre 1591–1598 gelten als Meisterjahre des Goltzius, in denen er Blätter schuf, die „zu den höchsten Leistungen des Kupferstichs aller Zeiten“ (Hirschmann 1919) zählen. 1593/1594 entstanden die „Meisterstiche“, eine Folge von sechs Blättern aus dem Marienleben. Vier davon sind eigenständige Interpretationen von Kompositionsschemata und Stilelementen verschiedener italienischer Spätrenaissancekünstler wie zum Beispiel Federigo Barocci (1526/1535–1612). Bei der „Beschneidung“ handelt es sich dagegen um die Übertragung von Albrecht Dürers (1471–1528) Holzschnitt aus dem Marienleben von 1503/1505 in den Kupferstich und die „Anbetung der Könige“ misst sich mit dem Kupferstich Lucas van Leydens (1494–1533) von 1513. In beiden Fällen griff Goltzius bewusst auf die Geschichte des Kupferstichs zurück. Ihm ging es über die Nachahmung hinausgehend um eine neue Erfindung im Geiste Dürers beziehungsweise van Leydens und das Übertreffen der technischen Fertigkeiten des Vorbildes. Dieser künstlerische Anspruch findet sich auf dem ersten Blatt der Folge: So wie Proteus sich mitten im Wasser verwandelte [...], so verwandelt sich jetzt Goltzius [...] durch seine vielfältige Kunst. Er ist ein wunderbarer Stecher und [Bild]Erfinder. Van Mander schrieb zu dieser Gabe der Verwandlungsfähigkeit: Indem er sich vergegenwärtigte, worin die Eigenart des Stils der Meister [...] bestehe, brachte er mit seiner Hand allein die Eigentümlichkeiten verschiedener Hände in Kompositionen eigener Erfindung zum Ausdruck. 1595 stellte ihm Kaiser Rudolph II. (Regierungszeit als Kaiser 1576-1612) ein Privileg aus, das den Nachdruck seiner Arbeiten bei Strafe für den Zeitraum von sechs Jahren im Reichsgebiet verbot. Für das Jahr 1597 ist belegt, dass Goltzius seine Stiche in Kommission nach Amsterdam, Frankfurt, Venedig, Rom, Paris und London lieferte. Wie geschätzt seine Arbeiten waren, zeigt sich an den gezahlten Preisen. So erhielt er 1592 für die Anfertigung zweier Porträtstiche und 500 Abzügen den hohen Betrag von 216 Gulden. Legt man den durchschnittlichen Tageslohn eines holländischen Handwerkers um 1600 von 14 Stuivers (1 Gulden = 20 Stuivers) zugrunde, dann entsprach die Summe mehr als einem Jahreslohn. M. Leesberg listet im jüngsten Werkverzeichnis 362 eigenhändige Kupferstiche, davon 292 nach eigenem Entwurf auf. Darüber hinaus lieferte Goltzius Vorlagen – meist lavierte und mit Deckweiß gehöhte Federzeichnungen – für etwa 150 von anderen ausgeführte Stiche. Zudem wurden von seinen Stichen viele, auch anonyme Kopien angefertigt.

Hendrick Goltzius, Leichnam Christi, gestützt von Engeln, Kupferstich nach Bartholomäus Spranger (1546-1611), 1587. (Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer)

Hendrick Goltzius, Die Beschneidung, Kupferstich, 1594. (Kunstsammlungen der Veste Coburg)
Die enorme Virtuosität und Wandlungsfähigkeit des Kupferstechers gilt auch für den Zeichner. Vielfach waren die mit dem Kürzel HG signierten und datierten Blätter als autarke Kunstwerke auch zum Verkauf gedacht. Neben vielen Entwurfsskizzen und Stichvorlagen sind besonders seine realistischen Porträts hervorzuheben, die er anfänglich noch mit dem Metallstift, später immer häufiger mit farbigen Kreiden zeichnete. Eine eigene Gruppe bilden ab 1580 die die Stichtechnik nachahmenden großen, technisch perfekten und sehr begehrten Federrisse auf Papier oder Pergament, die ihm den Titel "Monarch tussen de pennetekenenaars" (Monarch unter den Zeichnern mit der Feder) einbrachten. Insgesamt haben sich etwa circa 450 Zeichnungen des Goltzius erhalten.
Nachdem Goltzius etwa bei den Kreideporträts der Italienreise die Farbe immer noch zurückhaltend eingesetzt hatte, brach sie sich in den gegen Ende der 1590er Jahre entstandenen, nahezu bunten Stichvorlagen regelrecht Bahn. So erscheint seine Hinwendung zur Malerei im Jahre 1600 nur konsequent. Seine Gemälde mit zum Teil überlebensgroßen Figuren haben vorwiegend einen gelehrten, mythologischen Inhalt. Als Bindeglieder zwischen Graphik und Malerei mögen auch die beiden Federkunststücke gelten, bei denen Goltzius mit Feder und Tinte auf mit Ölfarbe grundierter Leinwand die Zeichnung anlegte und sie abschließend mit Ölfarbe überging. Seine Gemälde waren hochbegehrte Sammlerstücke, um deren Besitz sich auch Kaiser Rudolf II. bemühte. Sein Bilderaufkäufer berichtete aber nach Prag, dass sie für kein Gold feil seien.
Von der Hand des Goltzius existieren etwa 50 Ölgemälde, die sich mehrheitlich in öffentlichen Sammlungen befinden. Noch einmal so viele können aufgrund schriftlicher Quellen vermutet werden. Auch hier zeigt sich die Gabe, viele Quellen zu seinem persönlichen Stil zu assimilieren, die auch für seine Zeichnungen und Stiche charakteristisch ist. Hendrick Goltzius konnte bis an die Schwelle seines Todes künstlerisch tätig sein und starb in der Nacht zum 1.1.1617 im Alter von 59 Jahren kinderlos und sehr begütert. Er wurde am folgenden Tag in der Grote Kerk zu Haarlem beigesetzt.
Literatur
van Deursen, Arie Theodorus, Plain Lives in a Golden Age: Popular culture, Religion and Society in Seventeenth-century Holland, Cambridge University Press 1991.
Föhl, Hildegard, Hendrick und Hubert Goltzius und ihre Hinsbecker Künstlersippe Goltz, in: Heimatbuch des Landkreises Kempen-Krefeld (19) 1968, S. 251-257.
Hirschmann, Otto, Hendrick Goltzius, 1558-1617, Leipzig 1919.
The New Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450–1700, Hendrick Goltzius, 4 Bände, zusammengestellt von Marjolein Leesberg, Hg. Huigen Leeflang, Ouderkerk aan den Ijssel 2012.
van Mander, Carel, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (von 1400 bis ca. 1615), Übersetzung nach der Ausgabe von 1617 und Anmerkungen von Hanns Floerke, Worms 1991.
Meyers, Fritz, Hendrick Goltzius – van Bracht: Leben und Werk eines niederrheinischen Künstlers, in: Niederrheinisches Jahrbuch 11 (1969), S. 34-41.
Nichols, Lawrence W., The paintings of Hendrick Goltzius (1558–1617). A Monograph and Catalogue Raisonné, Doornspijk 2013.
North, Martin, Das Goldene Zeitalter. Kunst und Kommerz in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhundert, Köln/Weimar/Wien 2001.
Reznicek, Emil K. J., Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius, 2 Bände, Utrecht 1961.
Steeger, Albert, Meister Hubert von Hinsbeck – Jan Goltz von Kaiserswerth – Hubrecht Goltz von Venlo – Hendrick von Bracht: Zur 400. Wiederkehr des Geburtstages von Hendrick Goltzius aus Bracht, in: Der Niederrhein (Krefeld) 25 (1958), S. 38–43.
Strauss, Walter L., Hendrick Goltzius 1558–1617. The complete engravings and woodcuts, New York 1977.
Ausstellungskataloge (Auswahl)
Der Kupferstecher Hendrik Goltzius: 1558–1617, Ausstellungskatalog Kevelaer, Bergisch-Gladbach, Kempen, Kleve und Moers, Dez. 1982 bis Oktober 1983, Red. Robert Plötz, Kleve 1982.
Hendrick Goltzius (1558–1617). Drawings, prints and paintings, bearb. von Huigen Leeflang und Ger Luijten, Ausstellungskatalog Rijksmuseum, Rijksprentenkabinett, Amsterdam 2003.
Artisten der Linie. Hendrick Goltzius und die Graphik um 1600, Ausstellungskatalog Wallraf–Richartz–Museum und Fondation Corboud, Köln 2012.
Online
Schmidt, Wilhelm, „Goltzius, Hendrik“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879), S. 361-362. [Online]
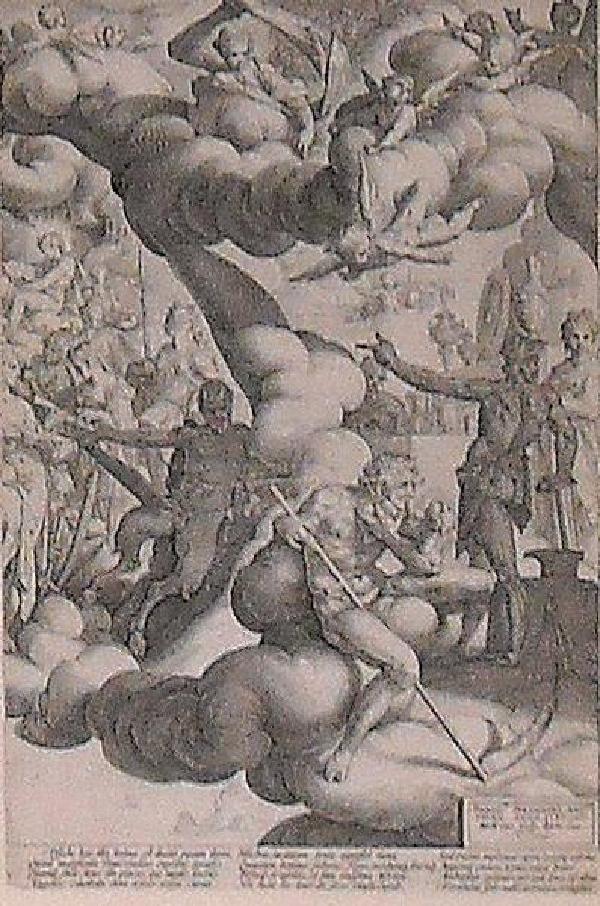
Hendrick Goltzius, Göttermahl, Ausschnitt: Hochzeit Cupido und Psyche, 1587. (Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer)
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Willemsen, Eva-Maria, Hendrick Goltzius, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hendrick-goltzius/DE-2086/lido/57c6c9c03f7915.92754094 (abgerufen am 26.04.2024)



