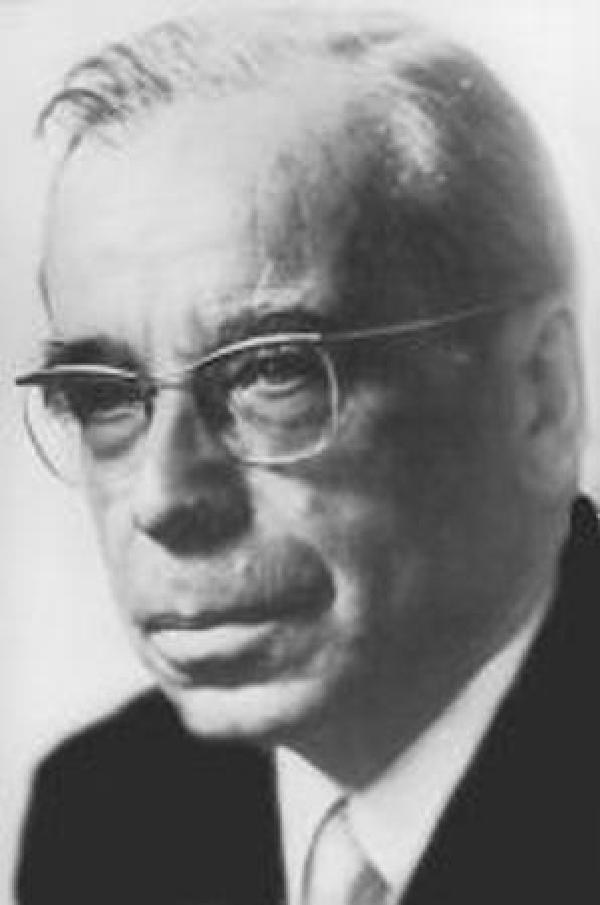Zu den Kapiteln
Ulrich Scheuner gehört zu den wenigen Universaljuristen im 20. Jahrhundert. Als Professor an der Universität Bonn befasste er sich, ausgehend vom Staatsrecht auch mit dem Völker- und dem Staats-(kirchen-)recht. In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gehörte Scheuner zu den einflussreichsten juristischen Politikberatern.
Scheuner, aus einer preußisch-protestantischen Beamtenfamilie stammend, wurde am 24.12.1903 in Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur in Münster studierte er dort und in München Rechtswissenschaft. Mit einer Arbeit „Die Lehre vom echten Parlamentarismus – ein Beitrag zur Systematisierung der Erscheinungsformen des parlamentarischen Regimes" wurde er 1925 von der Münsteraner Juristischen Fakultät promoviert. Nach glänzend bestandenem Assessorexamen ging Scheuner 1928 nach Berlin, wo er neben der Funktion als Fakultätsassistent auch Referent am Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht wurde. In Berlin wurde er unter der Betreuung des Staats- und Völkerrechtlers Heinrich Triepel und des Kirchenrechtlers Wilhelm Kahl mit einer unpublizierten Arbeit über die Regierung im Weimarer Verfassungssystem für die Fächer Staats- und Völkerrecht habilitiert – die venia legendi wurde im folgenden Jahr auf Verwaltungsrecht ausgedehnt. Als seinen eigentlichen Lehrer hat Scheuner jedoch den damals in Berlin lehrenden Staats- und Kirchenrechtler Rudolf Smend (1882-1975) angesehen (der um die Zeit des Ersten Weltkriegs in Bonn lehrte).
Es folgte eine steile akademische Karriere: von 1933 bis 1940 Professor in Jena, 1940 bis 1941 in Göttingen und seit 1941 an der Reichsuniversität Straßburg. Nach dem Krieg überbrückte er eine Zeit in Einrichtungen der evangelischen Kirche, bevor er 1949 zunächst als Lehrbeauftragter, seit 1950 bis zu seiner Emeritierung 1972 als ordentlicher Professor nach Bonn berufen wurde. Ulrich Scheuner hat die mehrfachen Wechsel des Herrschaftssystems während seiner wissenschaftlichen Tätigkeit begleitet: Die zur Weimarer Zeit verfasste Dissertation stellt noch heute eine klarsichtige Deutung des demokratisch-parlamentarischen Systems dar. Nach der nationalsozialistischen Herrschaftsergreifung publizierte er zahlreiche durchaus affirmative Arbeiten. Wegen dieser Belastung und wegen des Untergangs der „Reichsuniversität Straßburg" dauerte es bis 1950, ehe Scheuner wieder eine ordentliche Professur erhielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann seine wissenschaftliche und beratende Tätigkeit voll entfaltet: Scheuner wurde nicht nur wissenschaftlich wie institutionell einer der führenden Fachvertreter in Deutschland, er avancierte auch zu einem der wichtigsten staats- und völkerrechtlichen Berater der jungen Bundesregierung(en) – in den Worten Horst Ehmkes: angeleitet durch eine „barocke Affinität zur Macht und zum Gestaltungswillen". Die Berufung nach Bonn war ausdrücklich mit Hinweis auf seinen kirchen- und staatskirchenrechtlichen Ausweis hin erfolgt.
Scheuner wurde einer der wichtigen protestantischen Kirchen- und Staatskirchenrechtler der Nachkriegszeit, dessen Lehren bis heute prägend geblieben sind. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Protestant als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des (katholischen) Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands und als Leiter der (vom Ruhr-Bistum veranstalteten) Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche sogar mit einem hohen päpstlichen Orden ausgezeichnet wurde. Zusammen mit seinem Fakultätskollegen Ernst Friesenhahn gab er 1974 die erste Auflage des Handbuchs des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland heraus.
Methodisch war Scheuner – in Gefolgschaft seiner akademischen Lehrer Triepel und Smend – der so genannten antipositivistischen Richtung der deutschen Staatsrechtslehre zuzuordnen. Damit stand er auch in der frühen Bundesrepublik im Mainstream. Nicht in Monographien, sondern in zahlreichen Aufsätzen und Beiträgen zu Sammelwerken entfaltete seine Lehre Wirksamkeit. Bemerkenswert ist die Breite seiner Interessen: Scheuner publizierte im Schwerpunkt im Staatsrecht und im Staatskirchen- bzw. Kirchenrecht; gleichwohl findet sich eine ungewöhnlich große Zahl von völkerrechtlichen, verwaltungsrechtlichen, verfassungsgeschichtlichen und staatstheoretischen Werken. Scheuner war einer der letzten Fachvertreter des öffentlichen Rechts, die dieses sich stets weiter ausdifferenzierende Teilrechtsgebiet insgesamt nicht nur überblickt, sondern durch eigene Beiträge fortentwickelt haben.
Scheuner starb am 25.2.1981 in Bonn.
Schriften
Die nationale Revolution, in: Archiv des öffentlichen Rechts Neue Folge 24 (1934), S.166-344.
Schriften zum Staatskirchenrecht, Berlin 1973.
Schriften zum Völkerrecht, Berlin 1984.
Staatstheorie und Staatsrecht, Berlin 1978.
Scheuner, Ulrich / Friesenhagen, Ernst (Hg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2 Bände, Berlin 1974-1975.
Literatur
Häberle, Peter, Staatsrechtslehre als universale Jurisprudenz. Zum Tode von Ulrich Scheuner am 25. Februar 1981, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 26 (1981), S. 105-139.
Huber, Ulrich / Klaus Schlaich, Scheuner, Ulrich (1903-1981). In memoriam Ulrich Scheuner: Reden, gehalten am 24. Oktober 1981 bei der Gedächtnisfeier der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn 1982.
Listl, Joseph (Hg.), Ulrich Scheuner zum Gedächtnis, Bonn 1981.
Listl, Joseph, Staat und Kirche bei Ulrich Scheuner (1903-1981), in: Scheuner, Ulrich / Herbert Schambeck (Hg.), Demokratie in Anfechtung und Bewährung. Festschrift für Johannes Broermann, Berlin 1982, S. 827-906.
Schlaich, Klaus, Von der Notwendigkeit des Staates – Das wissenschaftliche Werk Ulrich Scheuners, in: Der Staat 21 (1982), S. 1-24.
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Waldhoff, Christian, Ulrich Scheuner, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ulrich-scheuner/DE-2086/lido/57c946bdc9fa65.12942273 (abgerufen am 26.04.2024)