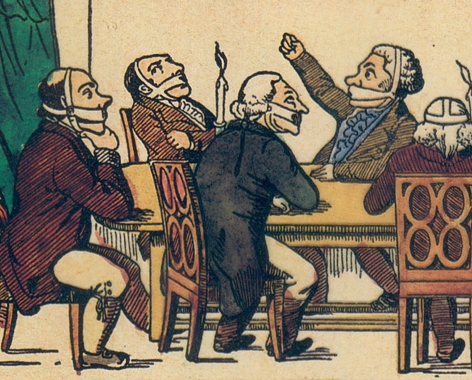Zu den Kapiteln
Schlagworte
1. Die Ausgangslage bis 1933
Drei Charakteristika prägten Koblenz seit dem frühen 19. Jahrhundert: Es war eine Beamten-, Rentner- und Soldatenstadt. Als Sitz des Oberpräsidenten der preußischen Rheinprovinz, des Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Koblenz sowie zahlreicher weiterer Justiz- und Verwaltungsbehörden war die Stadt an Rhein und Mosel eine ausgesprochene Beamtenstadt. Koblenz war außerdem eine der größten Garnison- und Festungsstädte Preußens, in der das Generalkommando des VIII. Armeekorps sowie viele andere militärische Kommandobehörden ansässig waren. Bis zur Entfestigung 1890 hemmten die Festungsrayons nicht nur die Stadterweiterung und die Einwohnerentwicklung, sondern verhinderten trotz verkehrstechnisch günstiger Lage auch die Ansiedlung größerer Industriebetriebe. Die reizvolle Landschaft ohne Fabrikschlote machte die Residenzstadt zu einem florierenden Fremdenverkehrsort und zog wohlhabende Rentner und Pensionäre an, die auf der Suche nach einem Altersdomizil waren. Der im Versailler Vertrag festgeschriebene Abzug des Militärs und die nachfolgende amerikanische beziehungsweise französische Besatzung (bis 1923 beziehungsweise 1929) bedeutete für die Stadt eine wirtschaftliche und soziale, aber auch mental tief greifende Zäsur. Versuche der Stadtväter in den 1920er Jahren, Industriebetriebe anzuwerben und so die wirtschaftliche Basis der Handels-, Verkehrs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstadt zu verbreitern, scheiterten, da Firmen unbesetztes Gebiet bevorzugten.
Zum Stichtag der Volkszählung vom 16.6.1933 hatte Koblenz 65.257 Einwohner. Davon waren 78,5 Prozent katholischer, 19,7 Prozent protestantischer und 1,0 Prozent jüdischer Konfession, 0,8 Prozent konfessionslos. Zwar gehörte das Rheinland zum Kernland der katholisch ausgerichteten Zentrumspartei, doch war Koblenz keine Hochburg des Zentrums. Es ging zwar aus allen Wahlen bis zur Reichstagswahl 1930 als stärkste Partei hervor, verfehlte aber auch bei Kommunalwahlen stets die absolute Mehrheit. 1918 spaltete sich sogar vom Koblenzer Zentrum eine Gruppe um einen populären Pfarrer ab, die sich 1919 und 1924 mit Erfolg zur Wahl stellte. Im Vergleich zum Reich war die Bedeutung von SPD und KPD gering, was auf den relativ kleinen Anteil an Arbeitern in der Bevölkerung und die späte Formierung der Parteien auf Ortsebene zurückging. Wesentlich stärker war dagegen das Gewicht der Liberalen (DDP, DVP, DNVP). Seit 1924 war in der Stadtverordnetenversammlung als lokale Gruppierung außerdem die von Stadtinspektor Karl Trampp (1892-1966) gegründete „Beamtenliste“ vertreten. Auf zwölf Jahre gewählt, war seit 1931 das Zentrumsmitglied Dr. jur. Hugo Rosendahl Oberbürgermeister, dem die Städteordnung für die Rheinprovinz von 1856 eine starke Machtposition und großen persönlichen Gestaltungsspielraum einräumte.

Blick auf Koblenz mit Deutschem Eck von der Festung Ehrenbreitstein, Ansichtskarte um 1930. (Stadtarchiv Koblenz)
1925 wurde die Ortsgruppe Koblenz der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gegründet. Sie gehörte zu dem von Gauleiter Dr. rer. nat. Robert Ley geführten Gau Rheinland-Süd (ab 1928: Gau Rheinland). Ab 1926 setzten massive Propaganda und Agitation der Ortsgruppe ein und es kam zu ersten blutigen Auseinandersetzungen mit Kommunisten. Am 27.3.1929 ernannte Ley den ehrgeizigen Diplom-Handelslehrer Gustav Simon zum neuen Bezirksleiter, der nach Koblenz zog und die zerstrittene Ortsgruppe neu aufbaute. Schon bei der Reichstagswahl am 20.5.1928 hatte die NSDAP trotz interner Zwistigkeiten einen ganz beachtlichen Wahlerfolg feiern können: Aus dem Stand heraus hatte sie mit 10,4 Prozent der Stimmen das Vierfache des Reichsergebnisses erzielt und die KPD um mehr als 1.000 Stimmen übertrumpft. Damit stand Koblenz in einer Reihe mit NSDAP-Hochburgen wie München, Nürnberg und Weimar. Die unermüdlichen Aktivitäten Simons trugen bei der Kommunalwahl am 17.11.1929 ihre ersten Früchte. Die NSDAP konnte bei einer niedrigen Wahlbeteiligung von nur 55 Prozent sensationelle 18,1 Prozent der Stimmen gewinnen und stellte damit acht von 44 Stadtverordneten. Der NSDAP war es nicht nur gelungen, die negativen Folgen von Versailler Vertrag, Besatzung und Separatismus geschickt für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die katholische Konfessionszugehörigkeit der Mehrheit der Koblenzer hatte sich nicht – wie andernorts – als Resistenzfaktor gegen den Nationalsozialismus erwiesen.

Oberbürgermeister Dr. Hugo Rosendahl, Porträt. (Stadtarchiv Koblenz)
Die NSDAP-Stadtverordneten und ihr Fraktionsführer Simon hatten keinerlei Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit im Stadtparlament. Ihrem Politikverständnis entsprechend, trugen sie Konfrontation und Kampf von der Straße in den Sitzungssaal. Seit dem 2.6.1930 unterstützte das neue Parteiorgan „Koblenzer Nationalblatt“ die aggressive Agitation. Ein Jahr später konnte Simon einen persönlichen Triumph verbuchen: Monatelang hatte er gegen den erklärten Willen seines erbosten einstigen Förderers, Gauleiter Ley, bei der NSDAP-Reichsleitung die Bildung eines neuen Gaues betrieben. Am 31.5.1931 wurde die Teilung des Gaues Rheinland vollzogen und Simon Gauleiter des neuen Gaues Koblenz-Trier. Derweil hatte die Stadt Koblenz, nunmehr auch Gauhauptstadt, mit immer größeren Finanzproblemen zu kämpfen. Die steigende Zahl der sogenannten Wohlfahrtserwerbslosen ließ die Fürsorgelasten explodieren und schnürte den Gestaltungsspielraum der kommunalen Selbstverwaltung finanziell immer weiter ein.

Gauleiter Gustav Simon, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
2. Machtkonsolidierung und Personalpolitik
Die Ernennung Adolf Hitlers (1889-1945) zum Reichskanzler am 30.1.1933 feierte die örtliche NSDAP mit einer großen Kundgebung am Deutschen Eck. Die ersten Folgen des Berliner Machtwechsels ließen auch in Koblenz nicht lange auf sich warten: Der Straßenterror weitete sich aus, erste Verfolgungsmaßnahmen bekamen KPD und SPD, aber auch das Zentrum zu spüren. Am 13. Februar wurde Polizeipräsident Dr. jur. Ernst Biesten (1884-1953), ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten, zwangsbeurlaubt. Bei der Reichstagwahl am 5.3.1933 errang die NSDAP 41,2 Prozent der Stimmen, während das Zentrum bei einer außerordentlich hohen Wahlbeteiligung von 92,5 Prozent nur noch 31,4 Prozent auf sich vereinigen konnte. Zum Erfolg der Rechten, der durch die 8,4 Prozent Stimmenanteil des Wahlbündnisses Kampffront Schwarz-Weiß-Rot komplettiert wurde, hatten vor allem die bisherigen Nichtwähler beigetragen. Am 7. und 8. März kam es auch in Koblenz, wie überall im Reich, zu illegalen Hissungen der Hakenkreuzfahne auf öffentlichen Gebäuden. Die Hissung auf dem Rathaus am 8. März geschah trotz des ausdrücklichen Protests von Oberbürgermeister Rosendahl, den SA-Männer unter Androhung von Gewalt aus seinem Dienstzimmer holten, um der Zeremonie von einem Fenster des großen Sitzungssaales beizuwohnen. Von einem gegenüberliegenden Balkon aus hielten der NSDAP-Stadtverordnete Karl Carius (1902-1980) sowie Fraktionsführer Ludwig Christ (1900-1938) Schmähreden auf Rosendahl und erklärten das faktische Ende seiner Amtszeit.

Jesuitenplatz mit Blick auf den Querflügel des Rathauses (im ersten Obergeschoss Großer Sitzungssaal): Hissen der Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus am 8.3.1933. (Stadtarchiv Koblenz)
Am 12. März, dem Volkstrauertag, fanden die Kommunalwahlen statt, die ebenfalls mit einem deutlichen Rechtsruck endeten: Die NSDAP wurde mit 42,0 Prozent stärkste Partei vor dem Zentrum mit 34,3 Prozent der Stimmen, der Deutsche Block Schwarz-Weiß-Rot erzielte 10,7 Prozent. Die Nationalsozialisten konnten sich damit auf 19 von 44 Stadtverordnetenmandate verbessern, während das Zentrum nur noch über 15 Sitze verfügte. Rosendahl trat am 15. März seinen Urlaub an; unter demselben Datum wurde er durch Verfügung des preußischen Innenminsters Hermann Göring (1893-1946) zwangsbeurlaubt. Schon am nächsten Tag wurde der Regierungs- und Gewerberat Otto Wittgen mit der kommissarischen Wahrnehmung der Amtsgeschäfte beauftragt. Wittgen, der erste evangelische Oberbürgermeister von Koblenz, war seit August 1932 NSDAP-Mitglied und hatte sich bereits als Vorsitzender des „Vereins zur Umschulung freiwilliger Arbeitskräfte Koblenz e.V.“ (später Arbeitsgau XXIV Mittelrhein des Reichsarbeitsdienstes) engagiert.

Nach der Amtseinführung von Oberbürgermeister Otto Wittgen am 16.3.1933 auf dem Balkon des Rathauses. Von links nach rechts (über dem Teppich): Kreisleiter Albert Müller, Gauleiter Gustav Simon, Wittgen (über der Hakenkreuzfahne), die Kommissare Ludwig Christ und Oskar Peter Hildebrandt. (Stadtarchiv Koblenz)
Noch am 16. März, dem Tag seiner Amtseinführung, setzte Wittgen zwei politische Kommissare ein: Ludwig Christ und Oskar Peter Hildebrandt (1902-1937), den Hauptschriftleiter des Nationalblatts. Die nächsten Monate waren dann von umfangreichen Ermittlungen und Untersuchungen der beiden „Revolutionskommissare“ und ihrer Helfer geprägt, die Vetternwirtschaft, Korruption und Verschwendung innerhalb der Stadtverwaltung „aufdeckten“. Ebenfalls noch am 16. März fielen die ersten drei Beamten den personellen Säuberungen zum Opfer. Bis zum 21. April beurlaubte Wittgen insgesamt neun Beamte, überwiegend Wahlbeamte oder leitende Beamte. Alle legten gegen ihre Zwangsbeurlaubung Widerspruch ein. Gegen sie wurden alte, längst erledigte Vorwürfe erhoben, neue, teils absurde Verfehlungen konstruiert, Disziplinarverfahren eingeleitet oder sogar Strafanzeige gestellt. Zwei Beamte schieden schließlich „freiwillig“ aus, vier weitere sowie Rosendahl wurden mit fadenscheinigen Begründungen aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.3.1933 zwangspensioniert, was für die Stadt nicht unerhebliche finanzielle Belastungen mit sich brachte. Die zweite Säuberungswelle betraf Angestellte und Arbeiter; eine ganze Reihe ehemaliger KPD-Mitglieder wurde entlassen.
Politisch unliebsame Bedienstete wurden auf diese Weise aus dem Dienst entfernt, während sich Parteimitgliedern, insbesondere Alten Kämpfern, nun ungeahnte Berufs- und Karrierechancen boten. Arbeitslose Parteigenossen wurden bevorzugt eingestellt. Im November 1934 waren 95 und im März 1935 schon 106 Alte Kämpfer als Arbeiter und Angestellte bei der Stadtverwaltung untergekommen, 1938 waren es 204 (18,4 Prozent der 1.107 Bediensteten einschließlich Lehrpersonal). Aber auch bei Beförderungen spielte das NSDAP-Parteibuch beziehungsweise das Datum des Parteieintritts nun eine entscheidende Rolle, die Bevorzugung von Parteigenossen war offenkundig. Zwar unterblieb 1933 ein umfassender Personalaustausch – wozu der Koblenzer NSDAP auch qualifiziertes Personal gefehlt hätte –, doch die Zwangsbeurlaubungen, Entlassungen, Disziplinarverfahren und Kommissarsaktivitäten dürften die städtischen Bediensteten eingeschüchtert haben. Dazu kam die Angst vor Denunziationen, denn in allen Ämtern saßen Kollegen, die als Vertrauensleute des Anfang 1934 als neuer berufsständischer Organisation gegründeten Reichsbunds der Beamten (RDB) fungierten. Durch sie unterstützt, übte Wittgen einen intensiven, permanenten Anpassungsdruck und Gesinnungsterror auf die Bediensteten aus. Zu den Gleichschaltungsmaßnahmen gehörten neben dem Gemeinschaftsempfang von Führerreden weltanschauliche Vortragsabende des RDB, aber auch interne Schulungen bis hin zum Einüben des nationalsozialistischen Liedguts. Ständig kursierten in der Stadtverwaltung Listen, die zum Beitritt in Parteiorganisationen wie die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV), zu Spenden oder zur Teilnahme an Parteiveranstaltungen aufforderten. Negativmeldungen waren oft schriftlich oder direkt dem Vorgesetzten gegenüber zu begründen, nicht selten erhielten der RDB oder Parteidienststellen eine entsprechende Mitteilung. Ständig appellierte Wittgen an die Vorbildfunktion der Beamten für die übrigen Volksgenossen. Dabei zeigte er bisweilen sogar die Tendenz, gesetzlichen Regelungen vorzugreifen: So verlangte er schon frühzeitig von den Beamtenanwärtern deren „freiwillige“ Meldung zum Reichsarbeitsdienst oder den Beitritt der Beamtenkinder zur Hitlerjugend. Im Mai 1935 waren circa 40 Prozent (178) der 447 Beamten und Angestellten NSDAP-Mitglied. Ab 1936 war die politische Beurteilung durch den Kreisleiter bei Einstellungen und Beförderungen zwingend vorgeschrieben. Sie war sein zentrales Herrschaftsinstrument, das auch außerhalb der Parteisphäre seine Wirkung zeigte. Politische Unzuverlässigkeit, die sich nicht nur in der Verweigerung des Parteieintritts äußern konnte, sondern auch durch den sonntäglichen Kirchgang oder die Zugehörigkeit der Kinder zu einer konfessionellen Jugendgruppe, bedeutete den Ausschluss von Beförderungen.

Oberbürgermeister Otto Wittgen, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
Die konstituierende Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung fand am 29.3.1933 in der voll besetzten, festlich geschmückten Stadthalle statt. Die KPD-Stadtverordneten waren erst gar nicht geladen worden (einer saß bereits in Schutzhaft) und die NSDAP-Stadtverordneten waren im Braunhemd erschienen. Einziger Tagungsordnungspunkt war die Ernennung Hitlers zum Ehrenbürger. Nachdem Wittgen den Antrag verlesen und bei der Abstimmung schnell dessen einstimmige Annahme festgestellt hatte, erhoben sich die beiden SPD-Stadtverordneten protestierend von ihren Sitzen. SS-Männer führten sie daraufhin aus dem Saal. Die nächste Sitzung am 19. April, wie gewohnt im Rathaus, war ein Meilenstein auf dem Weg zur Kaltstellung des Beschlussorgans als dem Kernelement der kommunalen Selbstverwaltung. Auf Antrag von NSDAP-Fraktionsführer Christ wurde gegen den Widerstand des Zentrums ein Beschlussausschuss eingesetzt, dem die Befugnisse der Stadtverordnetenversammlung fast vollständig übertragen wurden. Dagegen scheiterte die NSDAP mit ihrem Antrag, dem von ihnen bekämpften Amtsvorgänger Rosendahls, Oberbürgermeister Dr. Karl Russell (1870-1950), die 1931 verliehene Ehrenbürgerwürde zu entziehen, denn Wittgen trat diesem Antrag nicht bei. Christ wurde im Juni 1933 zum unbesoldeten Beigeordneten gewählt, schied aber schon im Oktober wieder aus, um Oberbürgermeister von Trier zu werden. An seine Stelle trat Anfang 1934 der NSDAP-Kreisleiter Rudolf Klaeber (1889-1966), mit dem die Partei aber bald unzufrieden war und der zur Stadtverwaltung Trier abgeschoben wurde. Gerade der Fall Klaeber, den Wittgen zu halten versuchte, machte deutlich, wie abhängig Personalentscheidungen in leitenden Positionen von den Wünschen des Gauleiters sein konnten. Wittgen selbst war am 4.8.1933 von den nach der Selbstauflösung des Zentrums noch verbliebenen Stadtverordneten einstimmig zum Oberbürgermeister gewählt worden. Seine Bestätigung im Amt nach Ablauf des Probejahres 1934 blieb aber lange fraglich, weil Gauleiter Simon erst in letzter Minute ein positives Votum abgab. Innerparteilich war Wittgen nämlich nicht unumstritten. Er galt als Pedant, hatte kein besonderes Parteiamt inne, das ihm eine eigene Hausmacht gesichert hätte, außerdem warf man ihm Initiativlosigkeit vor. Im Juli 1935 geriet Wittgen sogar in ernsthafte Bedrängnis, als der Einkauf seiner Frau im Kaufhof durch das antisemitische Hetzblatt „Der Stürmer“ bekannt wurde. Da der Kaufhof als arisch getarntes jüdisches Unternehmen galt, wurde Wittgens Frau aus der Partei ausgeschlossen. Zumindest vorübergehend war das Ansehen des Oberbürgermeisters in Öffentlichkeit, Verwaltung und Partei stark beschädigt.
Am 15.11.1934 tagten erstmals die 20 neuen Ratsherren der Stadt. Das Preußische Gemeindeverfassungsgesetz vom 15.12.1933, am 1.1.1934 in Kraft getreten, hatte das Führerprinzip eingeführt und aus dem Gemeinderat ein rein beratendes Gremium gemacht. Die Berufung der Gemeinderäte erfolgte auf Vorschlag des Gauleiters durch den Regierungspräsidenten. Kraft ihres Amtes waren der oberste örtliche NSDAP-Leiter sowie der rangälteste SA- oder SS-Führer Gemeinderäte. Die restlichen Ratsherren sollten verdiente Männer aus den für die Gemeinde typischen Berufsständen sein. In Koblenz wurden ausschließlich Parteigenossen berufen, wobei das sich in die Länge ziehende Verfahren die Personalnöte der Gauleitung offenbarte. Am 1.4.1935 trat dann reichsweit die Deutsche Gemeindeordnung (DGO) vom 30.1.1935 in Kraft, die ebenfalls den Oberbürgermeister als allein Verantwortlichen an die Spitze der Verwaltung stellte. Die NSDAP wurde als Staatspartei verankert, die über den „Beauftragten der Partei“ wichtige Mitwirkungsrechte erhielt. Wie vorgesehen, wurde diese Position in Koblenz durch den Kreisleiter ausgefüllt, das heißt zunächst durch Robert Claussen (1909-1941) und nach dessen Einberufung zum Kriegsdienst ab März 1940 durch Willi Cattepoel (1898-1986).

Sitzung der Stadtverordneten in der Stadthalle am 29.3.1933. Auf dem Podium Vertreter der Stadtverwaltung, in der Mitte Oberbürgermeister Wittgen, links davor die NSDAP-Stadtverordneten (wie Wittgen im Braunhemd), rechts die Stadtverordneten der übrigen Parteien. (Stadtarchiv Koblenz)
Als 1935 die dritte hauptamtliche Beigeordnetenstelle zu besetzen war, konnte Kreisleiter Claussen, der als Parteibeauftragter das Recht zur Vorauswahl der Bewerber besaß, seinen Favoriten, den NSDAP-Ortsgruppenleiter und Reichsbahnbeamten Hubert Fuhlrott (1896-1985), durchsetzen. Dazu war sogar eine Ausnahmegenehmigung des Oberpräsidenten erforderlich, denn seine Bewerbung war nicht fristgerecht eingegangen. Fuhlrotts Berufung Anfang 1936 ist ein typisches Beispiel dafür, dass politische Zuverlässigkeit im Zweifel mehr zählte als fachliche Qualifikation. Während sich Fuhlrott mit viel Fleiß in sein neues Aufgabengebiet als Wohlfahrtsdezernent einarbeitete, erwies sich die Wiederbesetzung der 1933 eingesparten Stelle des Technischen Beigeordneten im Frühjahr 1938 mit dem Parteifunktionär Hanns Klose (1895-1960) bald als Fehlbesetzung. Klose war mit seinem umfangreichen Aufgabengebiet überfordert, lieferte aber ein Musterbeispiel für das Prinzip „Dem Gauleiter entgegen arbeiten“ (Bernhard Gotto).
Das technische Dezernat hatte Wittgen 1933 selbst übernommen. Dass die Wiederbesetzung der Beigeordnetenstelle von den Aufsichtsbehörden gemäß § 110 DGO angeordnet wurde, stellte einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar und zeugte von der deutlichen Unzufriedenheit mit der Bearbeitung der (städte)baulichen Aufgaben. Schon seit Mitte 1936 war Wittgens Ablösung Gegenstand von Gesprächen zwischen Gauleiter, Regierungspräsident, Oberpräsident und Innenministerium. Doch Wittgen schaffte es drei Jahre lang, seine Versetzung beziehungsweise Pensionierung hinauszuzögern, indem er zur wachsenden Verärgerung seiner Verhandlungspartner auf seine volle Amtszeit und seine angestammten Beamtenrechte pochte. Nachdem schließlich ein finanzielles Arrangement gefunden worden war, beantragte er wegen angeblicher Dienstunfähigkeit seine vorzeitige Pensionierung zum 30.9.1939.

Kreisleiter Robert Claussen, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
In die Ära Wittgen fielen die Einweihung der Adolf-Hitler-Brücke (heute Europabrücke) am 22.4.1934 und der für die Stadtkasse kostspielige Besuch der Alten Garde der NSDAP am 24.6.1938. Auf zwei einschneidende Ereignisse hatte der Koblenzer Oberbürgermeister keinen Einfluss gehabt: die freudig begrüßte Remilitarisierung der alten Garnisonstadt am 7.3.1936 sowie die von Gauleiter und Regierungspräsident initiierte Eingemeindung der Stadt Ehrenbreitstein, der Gemeinden Metternich, Pfaffendorf, Horchheim, Neudorf und Niederberg sowie von Teilen von Urbar und Arzheim zum 1.7.1937.
Nachfolger Wittgens wurde der Wunschkandidat von Gauleiter Simon, Theodor Habicht (1898-1944), der frühere Landesinspekteur der NSDAP in Österreich und alte Kampfgefährte der rheinischen Nationalsozialisten. Habichts Amtszeit erwies sich aber nur als kurzes und bedeutungsloses Zwischenspiel: Schon wenige Wochen nach seiner feierlichen Amtseinführung am 4.7.1939 wurde er am 27. August mobilisiert. Habicht kehrte von der Front nicht wieder auf seinen Oberbürgermeisterposten zurück, sondern trat im November einen neuen Posten im Auswärtigen Amt an.

Oberbürgermeister Theodor Habicht, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
Hatte sich das Tauziehen um Wittgen und Habicht jahrelang hingezogen, ging die Einsetzung des nächsten Oberbürgermeisters geradezu hektisch und formalrechtlich fragwürdig vor sich, denn an einer langen Vakanz in einer großen Garnisonstadt in der Nähe der Westgrenze hatte niemand Interesse. Ohne die laufende Ausschreibung abzuwarten, schlug Kreisleiter Claussen Ende 1939 den Kreuznacher Landrat Dr. rer. pol. Nikolaus Simmer vor. Schon am 6.1.1940 wurde der ehrgeizige Wirtschaftsfachmann in sein Amt eingeführt. Simmer war mit seinen 37 Jahren nicht nur der jüngste Oberbürgermeister, den Koblenz je hatte, sondern auch das erste konfessionslose Stadtoberhaupt, denn er war aus der katholischen Kirche ausgetreten. In seinem späteren Spruchkammerverfahren hat Simmer immer wieder auf sein gespanntes Verhältnis zum Gauleiter, seinem ehemaligen Studienfreund, hingewiesen. Zwar hatte sich Simmer in der Vergangenheit mehrfach über Wünsche der Partei hinweggesetzt, jedoch hätte Simon in seiner Gauhauptstadt wohl kaum einen politisch unzuverlässigen Oberbürgermeister geduldet. Auch im besetzten Luxemburg betraute Simon als Chef der Zivilverwaltung Simmer mit diversen Aufgaben, was zu dessen häufigen Abwesenheit von Koblenz führte. Gleich zu Anfang seiner Amtszeit löste Simmer ein bereits länger schwelendes Personalproblem: Der Beigeordnete und Stadtkämmerer Dr. jur. Herbert Wirtz (1888-1970) schied nach massiven Querelen mit dem Kreisleiter „freiwillig“ aus der Stadtverwaltung aus und wechselte in die Privatwirtschaft. Claussen hatte Wirtz, der sich mehrfach finanziellen Forderungen der Partei widersetzt hatte, Sabotage vorgeworfen und wollte ihn aus der NSDAP ausschließen.

Oberbürgermeister Dr. Nikolaus Simmer, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
3. Wohlfahrtswesen, Bauwesen und Kultur
Drei „Alte Kämpfer“ in Folge als Wohlfahrtsdezernenten (Christ, Klaeber, Fuhlrott) sorgten für die Umsetzung der nationalsozialistischen Wohlfahrtspolitik mit ihren Förderungs- beziehungsweise Selektionskriterien und forcierten die Zusammenarbeit des Wohlfahrtsamtes mit der NSV. Entscheidend war jetzt, wie „wertvoll“ der Bedürftige für die Volksgemeinschaft in wirtschaftlicher, politischer oder rassebiologischer Sicht war. Es sollten nur noch die „würdigen“ Volksgenossen gefördert und die von Partei und Kommune gleichermaßen unerwünschte, „minderwertige“ Restklientel zur Betreuung an die konfessionellen Wohlfahrtsverbände abgeschoben werden. Schon am 2.5.1934 unterzeichnete die Stadt Koblenz als eine der ersten Städte überhaupt einen weit gehenden Kooperationsvertrag mit der NSV-Kreisleitung, der die Mitwirkung der NSV bei der neuen „Volkspflege“ regelte. Zu den wichtigsten Aufgaben der NSV zählten dabei die Begutachtung und Kontrolle der bedürftigen Volksgenossen. Die fünf Fürsorgebezirke der städtischen Fürsorgerinnen deckten sich ungefähr mit den sieben NSV-Ortsgruppenbezirken, auch die nach den Eingemeindungen von 1937 notwendige Neueinteilung in zehn Fürsorgebezirke orientierte sich ähnlich. Gleichzeitig wurde von der bisherigen Gruppenfürsorge auf die Einheitsbetreuung umgestellt. Organisatorisch, personell und finanziell war die NSV ihrer konfessionellen Konkurrenz aber zunächst noch klar unterlegen und die vorgesehenen Bearbeitungswege verlangsamten den Dienstbetrieb. Bei den Mündel- und Pflegekinderfällen intensivierte sich erst um 1937 die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und NSV-Kreisamt. Da die billigere Unterbringung in Familien der in Heimen vorgezogen wurde, war eine nationalsozialistische Erziehung der Kinder gewährleistet, denn seit 1937 wurden Pflegefamilien nur noch von der NSV vorschlagen. Zwar wurde der Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder (KFV, heute Sozialdienst Katholischer Frauen) bei der Betreuung zurückgedrängt, aber er blieb für das Jugendamt unentbehrlich, weil ihm die moralisch und rassisch minderwertigen Kinder überwiesen wurden. In dieser Nische konnte der KFV trotz gestrichener städtischer Zuschüsse das „Dritte Reich“ überleben, denn er nahm auf diese Weise eine wichtige Systemfunktion wahr.
Die Senkung der hohen Zahl der sogenannten Wohlfahrtserwerbslosen war für die Stadt nicht nur von finanziellem Interesse, sondern für Kommune und Partei auch eine Sache des Prestiges. Die Notstandsarbeiten aus der Weimarer Zeit wurden deshalb unvermindert fortgesetzt, gleichzeitig gab es Propagandakampagnen gegen Schwarzarbeit. Bei der Gewährung der Wohlfahrtsunterstützung für „Asoziale“ bewegte sich die Stadt Koblenz „im Mittelfeld“ der rheinischen Kommunen, das heißt sie ging weder besonders milde noch besonders rigide vor. Ab 1936 machte sich Wohlfahrtsdezernent Fuhlrott daran, die Fürsorgeempfänger in wiederholten Aktionen systematisch auszukämmen. Er ließ Leistungen kürzen oder sperren, weitete die Pflichtarbeit aus und regte sogar die Anstaltseinweisung von „Asozialen“ an. Nachdem die letzten, aufgrund Krankheit oder Alter nicht vermittelbaren Wohlfahrtserwerbslosen in den Armenstamm überführt worden waren, verschwanden sie im November 1938 aus der städtischen Statistik. Trotzdem lebten am 1.4.1939 noch rund 5 Prozent der Koblenzer Bevölkerung von der öffentlichen Fürsorge.
Bei der Behebung der Wohnungsnot zeigte sich die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität des „Dritten Reichs“ besonders drastisch. Die schon in der Weimarer Zeit begonnene Förderung der Kleinsiedlung wurde mit einer großstadtfeindlichen, agrarromantischen Blut- und Bodenidelogie aufgeladen. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Koblenz, wo die Stadt 1933 als Bauherrin der Stadtrandsiedlung Pionierhöhe auftrat. Projekte wie die SA-Dankopfer-Siedlung, die NSV-Siedlung und die Frontkämpfersiedlung im neu entstehenden Stadtteil Karthause wurden unterstützt und finanziell gefördert. Sie konnten aber den durch die Remilitarisierung noch stärker angespannten Wohnungsmarkt nicht entscheidend entlasten. Erst 1938 kehrte die Stadt mit dem Bau von 120 Arbeiterwohnstätten im Stadtteil Goldgrube zum sozialen Wohnungsbau mit zwei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern zurück. Diese Wende kam zu spät, denn der Krieg verhinderte dann die Realisierung weiterer größerer Projekte. Es blieb bei der Verwaltung des Mangels, der sich durch die Zerstörungen des alliierten Bombenkriegs nochmals verschärfte.

Das (Gau-)Amt für Volkswohlfahrt in der Neustadt 8, um 1937. (Stadtarchiv Koblenz)
Dem Wohnraummangel standen städtebauliche Großprojekte gegenüber, die unter dem prestigebewussten Oberbürgermeister Simmer Gestalt annahmen. 1937/1938 gab es bereits erste Pläne zur Umgestaltung des Areals um das Kurfürstliche Schloss, wo die erst im März 1935 eingeweihte Thingstätte kulturpolitisch schon wieder an Bedeutung verloren hatte. 1937 wurde das Stadterweiterungs- beziehungsweise Stadtplanungsamt eingerichtet, das 1938 mit dem Hochbauamt zum Stadtgestaltungsamt zusammengelegt wurde. Koblenz stand zwar nicht auf der Liste der sogenannten Neugestaltungsstädte, aber Hitler wünschte für alle Gauhauptstädte die Errichtung eines repräsentativen Gauforums. Während andernorts häufig der Gauleiter die Planung an sich riss, reklamierte in Koblenz Simmer die Oberhoheit für sich beziehungsweise die Stadt. Seine im Frühjahr 1941 veröffentlichten „Überlegungen zu den Ideenskizzen zur Neu- und Umgestaltung der Gauhauptstadt Koblenz“ setzten dazu ein deutliches Signal. Die Pläne ahmten vorhandene Vorbilder nach und waren zeittypisch gigantisch in ihren Dimensionen, ohne die Finanzierungsfrage zu berühren. Wichtige städtebauliche und wirtschaftspolitische Projekte, die Simmer verfolgte, waren die Verlegung des Hafen- und Industriegeländes vom Rauental in den Norden der Stadt und die Ansiedlung eines Werks der Firma Krupp für den Maschinenbau. Die für beide Vorhaben notwendige Eingemeindung der Landgemeinde Kesselheim scheiterte unter anderem am Widerstand des Landrats und die Verhandlungen mit Krupp wurden schließlich von Berlin auf Eis gelegt, da die Rüstungsindustrie Vorrang genoss. Ende 1941 präsentierte Simmer den verblüfften Ratsherren eine radikale Lösung des alten Problems Altstadtsanierung: Der Oberbürgermeister plante die völlige Niederlegung der historischen Altstadt, die Aufschüttung des Areals um drei Meter zum Hochwasserschutz und die Neubebauung. Die Umsetzung der Pläne verhinderte abermals der Krieg. Der löste das Problem schließlich auf andere Weise: Bis Anfang 1945 hatten Bomben die Innenstadt bei einem Zerstörungsgrad von 87 Prozent in ein Trümmerfeld verwandelt.

Siedlungsbauten im neuen Stadtteil Karthause, 1938. (Stadtarchiv Koblenz)
Simmers Auffassung von Kunst hatte rein instrumentellen Charakter, während der Lehrersohn, Musiklieber und Klavierspieler Wittgen noch volkserzieherische Ideale verfolgte. Im Kultursektor wurden Konkurrenz und Konflikte mit der Partei besonders offensichtlich. Vor allem die Zusammenarbeit mit der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude (NSG KdF) war schlecht. Ständig versuchte die der Deutschen Arbeitsfront angeschlossene Organisation, die Stadt einseitig für ihre Zwecke vor den Karren zu spannen, während sie selbst mit Terminen und Veranstaltungen wenig Rücksicht auf die städtischen Konzerte oder das Theater nahm. Auch einen angemessenen Anteil am Fördertopf Truppenbetreuung musste sich die Stadt erst erkämpfen. Von besonderer Qualität oder besser gesagt Rivalität war das Verhältnis zwischen Simmer und Gaupropagandaleiter Albert Urmes (1910-1985). Simmer wollte unter keinen Umständen den Ende 1941 von ihm gegründeten Kunstkreis, den er als autonomes städtisches Kulturinstitut führte, dem Gaukulturverband unterordnen und entzog sich hartnäckig diesbezüglichen Forderungen. Simmer verstand es, der Gauhauptstadt insbesondere durch zwei große, erfolgreiche Kunstausstellungen im Schloss 1943 und 1944 sowie Hochschulwochen und Vortragsreihen ein eigenes kulturelles Profil zu verschaffen, wobei ihn die Konkurrenz zu Trier und Luxemburg sowie zum Gaukulturverband anstachelte. Seine ambitionierte, von Teilen der Bevölkerung als elitär empfundene Kulturpolitik erfüllte neben ihrer Prestigefunktion aber auch eine ideologische, nämlich die „seelische Stärkung“ der Heimatfront. Doch insgesamt wurden der Selbstverwaltung im Kulturbereich durch den NS-Staat enge Grenzen gesteckt, was zum Beispiel in den Aufführungsverboten beziehungsweise -geboten im Theater- und Konzertwesen sowie in der Reglementierung und Kontrolle der Bibliotheksbestände deutlich wird. Auch gegen das staatliche Diktat der Theaterschließung Ende August 1944 war Simmer machtlos.
4. Die Umsetzung der NS-Verfolgungspolitik
Als unterste Verwaltungsinstanz hatte die Stadtverwaltung Gesetze, Erlasse und Verordnungen umzusetzen, die Verfolgungsmaßnahmen des NS-Unrechtsregimes darstellten und traditionelle Rechtsnormen verletzten. Durch den alltäglichen Vollzug des Unrechts, die „administrative Normalität“ (Bernhard Gotto), konnte es sich als neues „Recht“ im Bewusstsein der Bürger verankern und die bürgerliche Gesellschaft bewegte sich in Richtung der verheißenen „Volksgemeinschaft“. Zu fragen ist, inwieweit die Verfolgungspolitik von Verwaltungsseite aktiv unterstützt wurde, sie sich vielleicht mit städtischen Interessen deckte, die Beamten eigene Initiativen entwickelten oder aber Handlungsspielräume zugunsten Verfolgter ausnutzten.

Entwurf für das neue Rathaus am Löhrrondell, um 1941. (Stadtarchiv Koblenz)
Nach anfänglicher Zurückhaltung gegenüber den Kirchen ging die Stadtverwaltung bald dazu über, gesetzlich geregelte Zuschüsse beziehungsweise alte, aus Stiftungen herrührende Verpflichtungen einzusparen. Dies geschah teils auf Initiative der Ratsherren, während die Regierung die Stadt zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen anhielt. Das Kreuz auf der Leichenhalle des Hauptfriedhofs beließ man aus Rücksicht auf das religiöse Empfinden der Bevölkerung, doch waren derlei Skrupel bei der Abschaffung der Bekenntnisschule im November 1937 abgelegt. Wittgen unterstützte damit den antikirchlichen Kurs der Partei und des Staates. Die Kehrseite der Medaille musste die Stadt anlässlich der Schließung der katholischen Ursulinenschule erleben, die sie 1940 zur finanziell belastenden Eröffnung einer eigenen Mädchenoberschule zwang. Simmer entwickelte Pläne zur Inbesitznahme des begehrten Ursulinen-Schulgebäudes. Sie belegen in einmaliger Offenheit, dass er eine unrechtmäßige Aktion gegen den Ursulinenorden befürwortete oder sogar initiieren wollte, deren Nutznießer die Stadt gewesen wäre. Auch beim Waisenhaus Kemperhof wollte die Stadt ihre Interessen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Eigentümers, des Katholischen Männervereins für arme Knaben, und der Insassen durchsetzen. Selbst der regimekritische Beigeordnete Wirtz sah die vorübergehende Beschlagnahme des Waisenhauses als Hilfskrankenhaus 1939 als einmalige Chance für eine dauerhafte Besitzergreifung an. Dadurch wollte man eine früher verpasste Kaufgelegenheit zur Erweiterung des städtischen Krankenhauses Kemperhof wieder wettmachen.

Das Krankenhaus Kemperhof, Herzstück der Städtischen Krankenanstalten, nach einem Bombentreffer im Juni 1940. (Stadtarchiv Koblenz)
Die aufgrund eines alten Stadtverordnetenbeschlusses gewährte Bezuschussung der Synagogengemeinde schaffte Wittgen 1933 ab. Auch der Wirtschaftsboykott gegen die Juden fand seine Unterstützung, indem er jüdische Geschäftsinhaber von städtischen Aufträgen ausschloss. Dass dies auch die wirtschaftlichen Interessen der Stadt schädigen konnte, zeigt das Beispiel des Nutzviehmarktes. Dessen Direktor plädierte zwar für eine langsame Gangart bei der Verdrängung jüdischer Viehhändler zugunsten ihrer arischen Konkurrenten, um den materiellen Schaden zu minimieren. An sich wurde das Entfernen der Juden vom städtischen Markt aber nie in Frage gestellt, sondern sogar durch bauliche Maßnahmen gefördert. Bei den jüdischen Gaststätten- und Beherbergungsbetrieben war Beigeordneter Wirtz merklich bemüht, den Antragstellern zu einer Konzession zu verhelfen. Ausgerechnet Fuhlrott, ein fanatischer Parteigänger, erwies sich als Befürworter einer Konzessionierung, denn letztlich förderte sie die Segregation der Juden. Mit der Preisüberwachung bei der Arisierung von Immobilien kam auf die Stadt ein erheblicher Arbeitssaufwand zu. Stadtvermessungssrat Oswald Breuer (1880-1945) drängte dabei auf die beschleunigte Bearbeitung der Fälle, in denen die jüdischen Antragsteller ihre Auswanderung beabsichtigten.
Sowohl bei der Preisüberwachung als auch bei der Preisbildung der Mieten, die ein weiteres Gebiet der Auftragsverwaltung darstellte, bearbeitete die Stadt die Vorgänge sachlich-objektiv. Eine Benachteiligung oder Ungleichbehandlung jüdischer Antragsteller beziehungsweise Bevorzugung arischer Antragsteller lässt sich nicht erkennen. Auch der Verkauf von zwei Baugrundstücken an jüdische Erwerber und die anschließende Bauabwicklung zeigen keine Auffälligkeiten. Beim Erwerb „jüdischer“ Immobilien war die Stadt bei der Synagoge und der Privatklinik von Dr. Richard Reich (1889-1970) eindeutig Nutznießer. Angesichts ihrer Raumnot bemächtigte sie sich entschädigungslos der Synagoge und weit unter Wert der stattlichen Klinik. In beiden Fällen löste die Stadt im Restitutionsverfahren empörte Reaktionen der Betroffenen aus, indem sie den Zwangscharakter zunächst bestritt beziehungsweise die Wiedergutmachungsforderungen zu schmälern versuchte. Die Immobilie von Rosa Rosenblatt funktionierte die Stadt zu einem Judenhaus um. Dieser Fall dokumentiert gleichzeitig die Durchführung des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden vom 30.4.1939, die allein der Kommune oblag. Bei der Wohlfahrtsunterstützung der Juden schöpfte die Stadt nicht nur ihre rechtlichen Möglichkeiten voll aus, sondern umging – wie andere Städte – die Subsidiaritätsvorschrift und zahlte ab 1939 keinerlei Unterstützung mehr. Auf Anforderung der Gestapo stellte Fuhlrott 1942 bei zwei Deportationen eine beziehungsweise zwei städtische Fürsorgerinnen zur Verfügung, die sich durch ihr Mitleid aber als „unprofessionell“ erwiesen. Die 1941 laufenden Vorbereitungen für den Einsatz polnischer Juden zeigen, dass die Stadt sich deren Arbeitskraft wie der anderer Zwangsarbeiter bedienen wollte und sogar noch nach Möglichkeiten suchte, sie an den Kosten zu beteiligen.

Die Synagoge am Florinsmarkt (rechts daneben das Alte Kaufhaus). Nach der entschädigungslosen Aneignung durch die Stadt Koblenz Ende 1938 wurde hier 1939 das Wirtschafts- und Ernährungsamt untergebracht. (Stadtarchiv Koblenz)
Die nationalsozialistische Verfolgung der „Zigeuner“ wurde durch die städtische Verwaltung unterstützt, denn sie deckte sich mit ihren Interessen: Die „Zigeuner“ waren als Bewohner der Feste Franz beziehungsweise als zum Teil Nichtsesshafte unerwünscht. Eine wieder rückgängig gemachte Abschiebung nach Mitteldeutschland 1938 ging aber auf eine Initiative des Wiesbadener Regierungspräsidenten zurück. Dass die „Zigeuner“, wie Wohlfahrtsdezernent Fuhlrott behauptete, überwiegend von Wohlfahrtsunterstützung lebten, widerlegen die Akten vielfach. Gleichzeitig stellte er sie als Ärgernis für die Bevölkerung und als Sicherheitsrisiko dar, womit er auf ihre Unterbringung in einem Arbeitslager abzielte. Gesetzliche Unterstützungsleistungen enthielt die Stadt den „Zigeunern“ vor. An den Deportationen der Sinti und Roma 1940, 1943 und 1944 war die Stadt nicht unmittelbar beteiligt, sie übernahm 1940 aber einen Anteil an den Kosten des Transports.
Bei den Zwangssterilisierungen aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14.7.1933 musste die Stadt als Bezirksfürsorgeverband bei bedürftigen Betroffenen die Kosten übernehmen. Das städtische Krankenhaus Kemperhof war eines der Krankenhäuser, in dem die Eingriffe vorgenommen wurden. Die katholischen Ordensschwestern verweigerten die Mithilfe bei den circa 970 zwischen 1934 und 1944 durchgeführten Operationen, dagegen gab es beim ärztlichen Personal inklusive Chefarzt Prof. Dr. Fritz Hohmeier (1876-1950) offenbar keine Bedenken auszuräumen oder Widerstände zu überwinden. Auch die französische Militärregierung scheint an diesen „eugenischen“ Maßnahmen nach 1945 keinen Anstand genommen zu haben, erst 1949 standen die Zwangssterilisationen strafrechtlich zur Debatte.
Der Einsatz von Zivilarbeitern, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern war für die Stadtverwaltung wie für andere Betriebe willkommen und alltäglich. Angesichts des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels bemühte sie sich aktiv um deren Zuteilung beziehungsweise widersetzte sich deren Abzug. Bei den Instandsetzungs- und Räumarbeiten nach Bombenangriffen waren die Zwangsarbeiter fest einkalkuliert. Den städtischen Krankenanstalten wurden vom Arbeitsamt zunächst ohne eigenes Zutun Ostarbeiterinnen angeboten. Glaubt man der Chronik des Kemperhofs, fühlten sich die jungen Ukrainerinnen dort wohl. Als der Kemperhof auch kranke Ostarbeiter zu versorgen hatte, für die zwei Holzbaracken als Krankenstationen aufgestellt wurden, versuchte Verwaltungsleiter Johannes Schmitz (1888-1955), Zwangsarbeiter als Pflegepersonal zu erhalten. Unbotmäßiges Verhalten einer Ostarbeiterin brachte er nicht zur Anzeige, wohl aber einen Diebstahl durch einen ausländischen Krankenpfleger, der dessen KZ-Einweisung zur Folge hatte. Das von Fuhlrott für die Ostarbeiterinnen geforderte Verbot des Schlafens im Bunker umging Schmitz. In zwei Fällen meldete er vorschriftsmäßig die Schwangerschaft von Ostarbeiterinnen. Die Zwangsabtreibungen bei Ostarbeiterinnen wurden zunächst von Chefarzt Hohmeier und seinen Assistenzärzten durchgeführt. Als schließlich 1944 ein ukrainischer Arzt eintraf, schob Hohmeier ihm die Verantwortung für die Zwangsabtreibungen zu. Nach Kriegsende wehrte er sich, er hätte vergeblich religiöse und ethische Bedenken vorgebracht. Wenig glaubwürdig erscheinen dagegen Hohmeiers Einlassungen, es habe sich nur um Aborte und freiwillige Abtreibungen gehandelt.
5. Einsatz an der Heimatfront
Die Auftragsverwaltung für das Reich nahm seit Kriegsbeginn immer größere Ausmaße an und brachte für die Stadtverwaltung eine geradezu erdrückende Aufgabenlast mit sich (Luftschutzmaßnahmen und Bunkerbau, Einquartierungen und Beschlagnahmen, „Kriegsämter“: Wirtschafts- und Ernährungsamt, Kriegsschädenamt, Abteilung für Familienunterhalt, Amt für Sofortmaßnahmen). Einige der neu entstehenden Ämter entwickelten sich schnell zu den größten der Stadtverwaltung, während nicht kriegswichtige Arbeiten zurückstehen mussten oder ganz eingestellt wurden. Die zunehmende Unübersichtlichkeit der rechtlichen Bestimmungen sowie der durch Einberufungen stark ausgedünnte Personalbestand erschwerten den Arbeitsalltag. Der Mangel an Verwaltungsfachkräften konnte durch schnell angelerntes Aushilfspersonal, darunter viele Frauen, einigermaßen aufgefangen werden. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Akteure im polykratischen Geflecht des NS-Staates (Reichsverteidigungskommissar, Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung, Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, Einsatzstab des Gauleiters), in dem die Stadtverwaltung ihren Platz behaupten musste. Dies alles verlangte von den Bediensteten Flexibilität und Pragmatismus.

Rechnung des Transportbüros der Kölner Polizei für die Umsiedlung von Zigeunern nach Warschau am 21. Mai 1940. (Stadtarchiv Koblenz)
Verschiedene Ausführungen von Verwaltungsdirektor Jakob Müller (1895-1975) liefern ein Musterbeispiel dafür, wie die traditionelle Verwaltungspraxis zugunsten einer „Vereinfachung der Verwaltung“ aufgeweicht werden sollte. Bürokratieabbau sollte aber nicht nur der Effizienzsteigerung angesichts der vielfältigen Kriegsaufgaben und der Freisetzung Wehrfähiger für die Front dienen. Die Aufrechterhaltung einer raschen und reibungslosen Bedienung der „Volksgenossen“ bezweckte auch, dem Stimmungsverfall der Bevölkerung vorzubeugen. Es ging nicht nur darum, Beschwerden an höherer Stelle zu vermeiden, sondern eine angesichts der Mangelwirtschaft wachsende Unzufriedenheit einzudämmen, die letztlich das NS-Regime an sich in Frage zu stellen drohte.
Die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit der Kreisleitung - insbesondere mit Kreisleiter Cattepoel - bei der Einsatzplanung und der praktischen Katastrophenbewältigung nach Luftangriffen lief problemlos und unkompliziert. Die Ausgabe der Lebensmittelkarten erfolgte durch die NSV-Ortsgruppen, und die NSV wurde zur Verfügung über dezentrale Lebensmittellager ermächtigt. Bei der Beseitigung von Fliegerschäden war die kommunale Bürokratie auf organisatorischer und personeller Ebene eng mit der Partei verzahnt. Die Einteilung der Schadensbezirke orientierte sich zum Beispiel exakt an den Grenzen der NSDAP-Ortsgruppen, die Wiederaufbauleiter waren zur Zusammenarbeit mit den Ortsgruppenleitern verpflichtet und bei der Feststellung der Hinterbliebenen der Luftkriegstoten griff die Stadtverwaltung auf die Hilfe der Ortsgruppen zurück.

Hafen- und Verkehrsdirektor Franz Lanters, Porträtfoto. (Stadtarchiv Koblenz)
Die möglichst schnelle Verpflegung nach Bombenangriffen und die Wiederherstellung von Wohnraum, der Gas- und Wasserleitungen usw. gehörten zu den wichtigsten Voraussetzungen für die „Ruhigstellung“ der Bevölkerung. Die katastrophalen Luftkriegsfolgen konnten in einer gemeinsamen, arbeitsteiligen Kraftanstrengung von Stadtverwaltung und Partei trotz schwindender materieller und personeller Ressourcen erstaunlich gut und lange bewältigt werden. Sogar nach dem verheerenden Angriff des 6.11.1944 klappte die Krisenbewältigung noch leidlich, zu keinem Zeitpunkt herrschte das blanke Chaos. Verschiedene Äußerungen leitender Beamter zeigen, dass die Stadtverwaltung sich sehr wohl für die „Stimmung“ der Bevölkerung mitverantwortlich fühlte. Dies widersprach der offiziell geltenden Aufgabenteilung mit der Kreisleitung, die darin ein Kernanliegen der „Menschenführung“ der Partei sah. In der Praxis scheint dies für den Kreisleiter keine Rolle gespielt zu haben, was einmal mehr das pragmatische Ziehen an einem Strang angesichts der zu bewältigenden Probleme belegt. Die Maßnahmen der Stadt zur Gefallenenehrung (zum Beispiel 1939 Schaffung eines Ehrenfriedhofs, 1941 Anlage eines Kriegsehrenbuchs für die gefallenen Söhne der Stadt) legitimierten einerseits das massenhafte Sterben, andererseits halfen sie der Bevölkerung, zumindest „Haltung“ zu bewahren. Die Besorgtheit um die „Stimmung“ der Bevölkerung und die Ehrung gefallener Bürger waren aber wohl nicht ausschließlich ideologisch-politisch motiviert. Vielmehr gehörte es zum verinnerlichten Berufsethos der Beamten, sich für das Wohl der Allgemeinheit verantwortlich zu fühlen. Insgesamt gesehen erwies sich die Stadtverwaltung mit ihren Bediensteten als zentraler, zuverlässig funktionierender Bestandteil der Heimatfront, zu deren Stabilität sie ganz wesentlich beitrug.

Verpflegung der Bevölkerung nach einem Bombenangriff, 1944. (Stadtarchiv Koblenz)
Anfang 1945 kam es zum Zerwürfnis zwischen Oberbürgermeister Simmer und Gauleiter Simon, was nicht nur auf persönlichen Momenten und ihrer institutionell bedingten Rivalität beruhte, sondern auch auf den unerfüllbaren Forderungen des Gauleiters nach noch schnellerer Schadensbeseitigung. Der Oberbürgermeister hatte als „Leiter der Sofortmaßnahmen“ immer wieder selbst zur Eile angetrieben. Infolge dieses Konflikts wurde Simmer Mitte Februar 1945 einberufen, ihn ersetzte kommissarisch der Trierer Oberbürgermeister Dr. Konrad Gorges (1898-1968). Am 17.3.1945 rückten amerikanische Soldaten in das linksrheinische Koblenz ein. Gorges hatte sich befehlsgemäß über den Rhein abgesetzt und so war es Hafen- und Verkehrsdirektor Franz Lanters (1877-1956) vorbehalten, als Vertreter der Stadt um Schonung der Bevölkerung zu bitten.
Quellen
Die wichtigsten ungedruckten Quellen befinden sich in folgenden Beständen:
Stadtarchiv Koblenz, Best. 623, Bestandgruppe N,
Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 403, Best. 441, Best. 662,6, Best. 856.
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: Best. ehem. BDC, NS 25, R 36, R 43-I, R 43-II, R 55, R 1501,
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Rheinland, Best. NW 6, Best. RW 50-53.
Literatur
Bellinghausen, Hans (Hg.), 2000 Jahre Koblenz. Geschichte der Stadt an Rhein und Mosel, 2. erweiterte Auflage Boppard 1973.
Boberach, Heinz, Nationalsozialistische Diktatur, Nachkriegszeit und Gegenwart. In: Geschichte der Stadt Koblenz, Band 2, Stuttgart 1993, S. 170-223, 571-577.
Bucher, Peter, Koblenz während der nationalsozialistischen Zeit, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 11 (1985), S. 211-245.
Fleiter, Rüdiger, Stadtverwaltung im Dritten Reich. Verfolgungspolitik auf kommunaler Ebene am Beispiel Hannovers, Hannover 2006.
Gotto, Bernhard, Dem Gauleiter entgegen arbeiten? Überlegungen zur Reichweite eines Deutungsmusters, in: John, Jürgen [u. a.] (Hg.), Die NS-Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen „Führerstaat“, München 2007, S. 80-99.
Gotto, Bernhard, Nationalsozialistische Kommunalpolitik. Administrative Normalität und Systemstabilisierung durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933-1945, München 2006.
Jeserich, Kurt G. A. [u. a.] (Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985.
Matzerath, Horst, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, Stuttgart 1970.
Mecking, Sabine/Wirsching, Andreas (Hg.), Stadtverwaltung im Nationalsozialismus. Systemstabilisierende Dimensionen kommunaler Herrschaft, Paderborn 2005.
Mommsen, Hans, Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur nationalsozialistischen Beamtenpolitik, Stuttgart 1966.
Rebentisch, Dieter/Teppe, Karl, Einleitung, in: Rebentisch, Dieter/Teppe, Karl (Hg.), Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1986, S. 7-32.
Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816-1945, Düsseldorf 1994.
Weiß, Petra, Die Stadtverwaltung Koblenz im Nationalsozialismus. Diss. Fernuniversität Hagen 2011.

Ein amerikanischer Soldat auf einem Beobachtungsposten am Görres-Denkmal in den Rheinanlagen, März 1945. (Stadtarchiv Koblenz)
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.
Weiß, Petra, Die Stadtverwaltung Koblenz im Nationalsozialismus, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-stadtverwaltung-koblenz-im-nationalsozialismus/DE-2086/lido/57d1345d839016.94615437 (abgerufen am 08.05.2024)